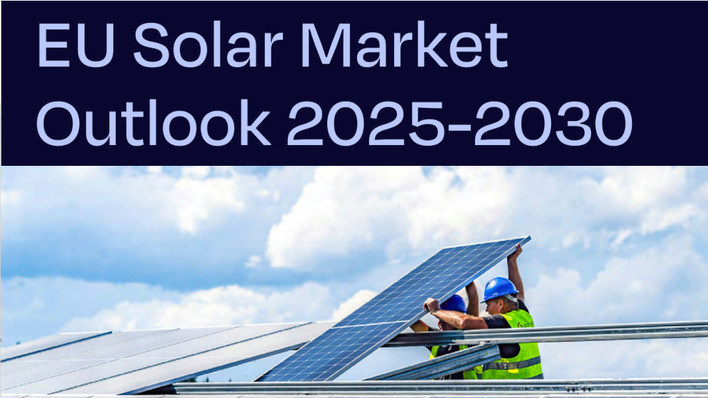Emotionen bremsen, hinter vordergründigem Streit verdeckte Interessen klären, gute kommunikative Ebenen schaffen und Transparenz über das herstellen, was zur Diskussion steht und was nicht: Das sind gemäß den Mediationsexperten Gisela Kohlhage und Matthias Bruhn die entscheidenden Schachzüge in der Spielkunst der Windparkkommunikation. Die beiden professionellen Dienstleister vermittelten auf einem Windenergie-Treffen am Dienstag in Hannover in einem moderierten Erfahrungsaustausch mit interessierten Juristen, Windparkprojektexperten, Gutachtern und Investoren die Vielfalt von zu klärenden Konflikten und Widerständen. Diese entstehen beim Aushandeln der Interessen an einem geplanten Windparkstandort verlässlich, so lautete eine weitere und für die Beteiligten wenig überraschende Erkenntnis aus dem Erfahrungsaustausch mit den Mediatoren.
So listete eine der in Arbeitsgruppen zum Erfahrungsaustausch eingeteilten Teilnehmendenrunden die Probleme in der Diskussion mit örtlichen Bürgerinnen und Bürgern auf: bei Bürgeranhörungen unkontrollierbare emotionale Dynamiken und Diskussionen, Ängste oder eine verirrte Diskussion auf einer schiefen kommunikativen Ebene. Konkret sei das nach einem Filmtitel benannte Phänomen „Angst essen Seele auf“ zu vermeiden, berichtete ein Sprecher dieser Runde: Sind irrationale Befürchtungen beispielsweise vor gesundheitlichen Schäden durch sogenannten Infraschall, aber auch vor verbauten Landschaften im Spiel, setzt die Fähigkeit zum Austausch zwischen Interessengruppen rings um einen geplanten Windparkstandort aus.
„Es gibt keine Pille gegen Ängste“, kommentierte Kohlhage das häufige Kommunikationsproblem bei Anwohnerängsten. Doch gute Mediation als Vermittlung von Interessen und Perspektiven begreife Emotionen als Königsweg, um Bedürfnisse hinter der vordergründigen Kritik an Windparkprojekten sichtbar werden zu lassen.
Allerdings müssen sich die Projektverantwortlichen darüber klar sein, welche Themen sie diskutieren lassen wollen wie zum Beispiel den Infraschall und welche am Verhandlungsspielraum vorbeiführen.
Zu klären ist vor einer Bürgerdiskussion über Windparks auch schon, wer zu ihr einladen soll. Gemeinden könnten dies tun, um hohe Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit für einen Austausch über ein Windparkprojekt herzustellen. Allerdings brauchten gute Bürgerrunden viel Vorbereitung, so erklärten die Mediatoren. Systematisches Klären der Rahmenbedingungen und des Verhandlungsspielraumes nimmt Zeit in Anspruch. Wichtig sei, die Sprechfähigkeit der Anwohnenden-Initiativen und Naturschutzverbändedurch Mandatsklärung, zum Beispiel durch eine Sprecherwahl, zu gewährleisten. Ein Fonds zur Finanzierung der Dialoggestaltung und zum Bezahlen von Kommunikationsexperten könne zudem gewährleisten, dass nicht der Einfluss einzelner Mittelgeber größer ist als der anderer Akteure.
Eine andere Teilnehmenden-Runde an dem Windpark-Kommunikations-Seminar berichtete vom Konflikt eines einzelnen Investors mit einem von ihm beauftragten Projektierungsdienstleister. Obwohl beide Parteien dasselbe wollten und sich mehrmals in Vorgesprächen über ihre Kommunikationswege und über die Muster ihrer Zusammenarbeit verständigt hatten, greife ihre Zusammenarbeit nicht ineinander. Der Investor kann sein besseres Wissen über die Situation am Projektstandort seiner Meinung nach nicht einbringen, die Projektierungsgesellschaft sieht sich in den Abfolgen von gut eingeführten Projektierungsschritten und ihrem Bedarf, auch andere Projekte zeitgleich voranzutreiben, gestört.
Matthias Bruhn riet daraufhin dazu, Nachsorgetermine anzusetzen, um regelmäßig zu prüfen, inwiefern beide Seiten ihre Kommunikationsabsprachen einhalten.
Als Beispiel, wie falsche Debatten die wirklichen Konflikte verbergen, berichtete eine Runde von Grundstücksinhabern, die fehlende Rückbaustandards monieren, aber tatsächlich ihr Land nicht mit der eigentlichen Turbine bestückt sehen wollen und es vielmehr als Abstandsfläche zur Verfügung stellen würden.
Die Mediatoren stoßen indes immer wieder auf ein grundsätzliches kommunikatives Problem. Oftmals seien sie dem Verdacht ausgesetzt, sie hörten Bedenken und Kritik nicht zu, um diese zu verstehen, sondern um sie zu entkräften. „Es ist deshalb ratsam, von Beginn an Transparenz darüber herzustellen, über was sich reden lässt und was im aktuellen Status der Projektierung schon feststeht." Mediation müsse dann lieber Argumente für den Windpark von den Anwohnenden einbringen lassen, als Kritik an Windparkplanungen selbst entkräften zu wollen, sagte Mediator Bruhn. „Wir Mediatoren moderieren stattdessen“.
Wie mit Totalverweigerern an einem Austausch über ein Bauvorhaben umzugehen ist, thematisierte eine der drei Runden ebenfalls. Wichtig ist, die Sorgen ernst zu nehmen, und nicht nur so zu tun. Alles andere wäre, böse ausgedrückt „Akzeptanzbeschaffung“, stellte Mediatorin Kohlhage klar. Wichtig sei es im Umgang gerade auch mit Totalverweigerung, Beteiligungsprozesse in unterschiedlichen Formaten anzubieten und das jeweilige Mitgestaltungspotenzial klar zu benennen: Infoveranstaltungen, in denen die Teilnehmenden nur zuhören und in einem festgelegten Frageblock womöglich noch Fragen stellen können. Abstimmungsveranstaltungen zur Wahl von Optionen. Erörterungsrunden, um Optionen zu bestimmen. Auch Veranstaltungen, die über mögliche Ausgleichsmaßnahmen für Natur- oder Anwohnerschutz verhandeln lassen, seien denkbar, sagte ihr Berufskollege Bruhn.
Auch unterschiedliche Unternehmenskulturen versöhnen, wo zwei Unternehmen ein Joint Venture gründen, ist eine Aufgabe für eine gute Mediation. Ebenso wird sinnvolle Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an einem Windparkprojekt durch kluge Dialoggestaltung erfolgreich. Dazu gehöre nicht zuletzt auch die Verständigung mit allen Profiteuren darüber, wie sie durch Abgabe eines Teils der Erträge an die Anwohnenden oder die Kommune dem öffentlichen Frieden dienen können, an dem sie selbst interessiert seien. So lautete die zum Abschluss vernehmbare Botschaft.
Gisela Kohlhage ist Gründerin der Participolis Akademie, Matthias Bruhn führt das Mediationsunternehmen Mediation und Training. Ihr Workshop am Dienstag in Hannover „Immer Ärger im Projekt“ fand am Rande des Windenergie-Branchentreffs Spreewindrunde statt.