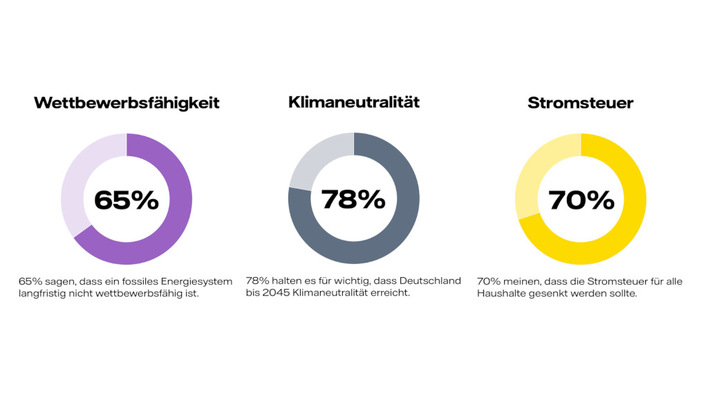Vor „erheblichen Risiken“ und „massiven Risiken“ des deutschen Ausschreibungs- und Vergabemodells warnt nun die Stiftung Offshore-Windenergie nach Vorlage einer Analyse der 2022 eingeführten und seit 2023 gültigen aktuellen Regeln für Meereswindparkausschreibungen. Durch sie drohe ein gewandelter deutscher Offshore-Windkraft-Markt zu entstehen, der „langfristig deutlich negative wirtschaftliche und energiepolitische Folgen haben könnte“.
Die vor 20 Jahren vom Bundesumweltministerium initiierte Stiftung hat die Aufgabe, die Bedeutung der Offshore-Windenergie für die Energiewende zu stärken und den Ausbau der Meereswindkraft auch europaweit mit voranzutreiben. Nun hat sie eine Analyse über die Wirkung der aktuellen nationalen Ausschreibungsregeln vorgelegt. Zu einer solchen Analyse fordert die Europäische Union (EU) alle EU-Mitgliedsländer mit Offshore-Windenergie-Nutzung auf. Der Wortlaut ihrer Mitteilung zu den Ergebnissen der Analyse ist ähnlich wie der einer Meldung aus dem Vorjahr, als die Stiftung Offshore-Windenergie bereits „massive industrie- und wettbewerbspolitische Kollateralschäden“ befürchtete. Wie schon vor einem Jahr in einem damaligen gemeinsamen Aufruf mit anderen Offshore-Windenergie-Organisationen fordert die Stiftung die Bundesregierung zu einer schnellen Reform der Ausschreibungs- und Vergaberegeln auf.
Die deutsche Politik zu alarmieren, fällt der Offshore-Windkraft-Branche schwer. Denn jenseits des global dominierenden Windkraftlandes China ist der deutsche Offshore-Windkraft-Markt dank der Reformen der jüngst abgewählten rot-gelb-grünen „Ampel“-Koalition aus SPD, Grünen und FDP zum global zweitwichtigsten Offshore-Windpark-Ausbauland geworden: nur noch hinter dem führenden europäischen Offshore-Windkraft-Land Großbritannien. Ein klarer Fahrplan für schnelle und regelmäßige Ausschreibungen großer Volumen bis 2032 regelt für unser Land zunächst den Ausbau bis 2037 um 38 Gigawatt (GW). Diese Erzeugungskapazität soll die bis 2028 aus vorangegangenen Ausschreibungen entstehende Erzeugungskapazität von rund 15 GW aufstocken und damit dem Ziel einer bis 2045 geplanten Kapazität von 70 GW nahe zu kommen.

Nicole Weinhold
Doch die Ampelkoalition hatte sehenden Auges einen besonders scharfen Wettbewerb eingeführt, vermutlich weil sie sich über dessen Ziele nicht einig war oder zumindest zu viele Ziele zugleich zu verfolgen suchte: Niedrige Strompreise, schneller verlässlicher Zubau, eine in Deutschland entstehende und wachsende Wertschöpfungskette, EU-weiter freier Wettbewerb und möglicherweise das Entstehen nationaler Champions, um ausländische Windkraftmärkte auch für deutsche Investitionen und Exporte zu erschließen.
Seit 2023 unterscheidet das Windenergie-auf-See-Gesetz in Ausschreibungen für staatlich zentral voruntersuchte Meeresflächen und Ausschreibungen für nicht zentral voruntersuchte Flächen. Dabei zählen bei den Ausschreibungen für zentral voruntersuchte Flächen zu einem geringeren Anteil erstmals die qualitativen Kriterien einer Ausbildungsquote in windenergiespezifischen Tätigkeiten, des Grünstromanteils in der Produktion der eingeplanten Windenergieanlagen, umweltschonende Verfahren für das Eintreiben der Turbinenfundamente in den Meeresboden und ein möglichst hoher Anteil langfristiger Stromlieferverträge an der späteren Stromvermarktung. Hauptsächlich zählen aber die niedrigsten Vergütungsforderungen für eventuelle spätere Einspeisetarife oder die höchsten Gebote für freiwillige Zahlungen einer Nutzungsgebühr für die Entwicklungsflächen. Die Ausschreibungen für nicht-zentral-voruntersuchte Flächen setzen dagegen komplett auf einen starken finanziellen Bieterwettbewerb, weil eine ungedeckelte Ausschreibung in vielen Gebotsrunden mit nur langsam steigenden Gebotshöhen die Bieter zu Milliardenzahlungen verleitet. So setzten sich 2023 in einer Runde zwei Ölkonzerne alleine für Entwicklungsflächen für 7 GW durch, so viel wie die Windparks auf See in den zehn Jahren davor insgesamt ans Netz gebracht hatten. Sie müssen demnach in den kommenden 25 Jahren Betriebszeit ihrer geplanten Windparks 13,4 Milliarden Euro für ihre Nutzungsrechte der See-Windparks-Standorte an den Staat abliefern. Der will mit Hilfe dieser Einnahmen vor allem die Stromnetzgebühren für einspeisende Windparks senken.
Die Sofortforderungen der Stiftung Offshore-Windenergie lauten wie vor einem Jahr eine Einführung zweiseitiger Differenzverträge – Contracts for Difference (CFD) genannt. Sie legen einen Mindestpreis für die Einspeisung fest, die der Staat den Windparkbetreibenden auch über die Einnahmen aus dem Stromhandel hinaus zusichert und bei tieferen Stromhandelspreisen durch Zuschüsse ausgleicht. Erzielen die Windparkbetreibenden auf den Strommärkten höhere Einnahmen oberhalb des vertraglichen Mindestpreises, müssen sie diese Mehrerlöse an den Staat zurückzahlen. Auch eine Begrenzung der Ausschreibungsvolumen pro Bieter fordert die Stiftung, um eine größere Akteursvielfalt in den Projektentwicklungen zu sichern. Neue sinnvollere quantitativere Kriterien wie einen geringeren CO2-Ausstoß pro zugelieferter Großkomponenten will die Stiftung ebenfalls eingeführt sehen – würde das ja in Europa hergestellte und von weniger weit transportierte Großkomponenten aus europäischer Herstellung im Vergleich zu Importen aus Asien und insbesondere aus China bevorzugen. Auch eine Präqualifikation der Bieter nach den EU-Regeln des Net Zero Industry Acts (NZIA) fordert die Stiftung. Der NZIA verlangt eine Reihe von Maßnahmen, um eine europäische Industrie für Energie-Nachhaltigkeitstechnologien zu entwickeln.
Die Offshore-Windbranchen-Vertreter fürchten nicht zuletzt, dass viele Offshore-Windkraftprojekte durch die Vergabe sehr großer Volumen an nur wenige Marktteilnehmer zu einer ungesunden Marktmacht dieser neuen Offshore-Windkraft-fremden Akteure führen. Sie könnten versucht sein, mit dem Ausstieg aus möglicherweise nicht rentablen Zuschlägen zu drohen, um bessere Vergütungen oder geringere Zahlungen nachzuverhandeln. Außerdem könnte ihre Marktmacht dazu führen, einen ganz neuen noch stärkeren Preisdruck auf die Zulieferindustrie aufzubauen und dadurch Importe besonders günstiger asiatischer und chinesischer Technologien und Windenergieanlagen zu fördern.
Weil die langfristigen Zahlungen der bezuschlagten Bieter ohnehin auch die Netzumlage für die Windstromeinspeisung kaum senken, wie nun die Analyse belegt, plädiert die Branche bereits seit dem Vorjahr für Regeln, die eine Umsetzung der Projekte einerseits wahrscheinlicher machen: Indem beispielsweise mehr Zahlungen der Bieter schon vor der Investitionsentscheidung erfolgen könnten, um den Preis für ein Aussteigen aus dem Projekt zu erhöhen.
Kompliziert ist die Sache für die deutsche Offshore-Windkraft gerade deshalb, weil sie so vielen Zielen zugleich dienen soll – und sich auf eine EU-Offshore-Windkraftpolitik verlassen will, die trotz sehr weitreichender Ziele und mehrere zwischenstaatlicher Absichtserklärungen bisher bestenfalls zu einem stagnierenden Kapazitätsausbau führt. Das ist auch deshalb so, weil europaweit zuletzt mehrere Ausschreibungen mangels Beteiligung irgendwelcher Bieter gescheitert sind.
Sowohl die Offshore-Windkraft-Branche als auch die Politik in Deutschland und Europa brauchen den Mut, sich bei den Zielen für ihre Offshore-Windkraft auf wenige zu einigen. Und ohne Angst vor chinesischer oder sonstiger außereuropäischer Konkurrenz die Wettbewerbsregeln nicht ständig zu ändern, um Märkte vermeintlich effektiv abzuschotten. Qualitative Präqualifizierungsregeln müssen nämlich zuallererst auch für die hiesige Zulieferindustrie sinnvoll sein. Verlässliche Rahmenbedingungen sind nämlich insbesondere auch solche Rahmenbedingungen, die stabil sind.