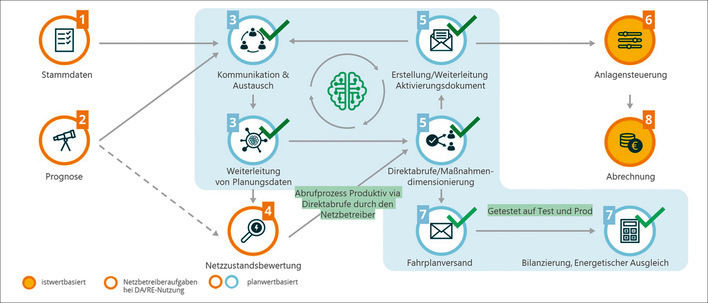Die wahre Größe der Anlage lässt sich kaum erahnen. Wenn man von der Insel Karmoy über das Wasser blickt, sieht man einen kleinen weißen Strich am blauen Horizont. Selbst wenn man mit dem Schiff langsam herantuckert, ist die Windenergieanlage (WEA) nicht wirklich beeindruckend – verglichen mit jenen, die heute an Land errichtet werden. 65 Meter Nabenhöhe nehmen sich geradezu bescheiden aus neben den 120 Metern, die heute onshore aufgepflanzt werden. Doch die Hywind-Anlage hat es in sich. Ihr dickes Ende liegt unter Wasser. Hywind ist die erste Windenergieanlage, die freischwimmend im Meer steht. Ein gut 100 Meter langer Stahlkörper hält sie aufrecht wie ein Bleigewicht das Badewannenthermometer – ein gigantisches Rohr von 8,3 Metern Durchmesser, so breit wie ein Einfamilienhaus. Zwei Schwerlastauflieger mit mehr als 40 Achsen waren nötig, um das Monster im Frühsommer 2009 zur Hafenpier zu bugsieren. Seit Juni letzten Jahres reckt sich die Anlage zehn Kilometer vor der norwegischen Insel in den Himmel. Drei Monate später wurde sie an das norwegische Stromnetz gekoppelt. Seitdem hat sie die meiste Zeit Strom geliefert – abgesehen von Phasen, in denen Tests oder Wartungsarbeiten anstanden.
Im Grunde ist Hywind ein Prototyp, denn sie ist die erste Anlage ihrer Art. Nirgendwo sonst schwimmt derzeit eine vergleichbare WEA im Meer – schon gar nicht im Routinebetrieb. Die Genehmigung für eine Einspeisung ins Stromnetz ist für gewöhnlich ein Ritterschlag für eine neue regenerative Technologie. Dass das Projekt ihn vom Fleck weg bekommen hat, liegt nicht zuletzt daran, dass hier potente Industriepartner gemeinsam am Werk sind – der Technologiekonzern Siemens und das norwegische Energieunternehmen Statoil. 45 Millionen Euro investierten die beiden Konzerne in ihre Entwicklung.
Mit Ballasttank sicher im Wellengang
Bei der Konstruktion der Schwimmerstruktur konnte Statoil auf seine Erfahrung aus der Offshore-Ölindustrie zurückgreifen. Der Schwimmkörper funktioniert nach dem „Spar-Buoy-Prinzip“, das schon viele Jahre für schwimmende Bohrinseln eingesetzt wird. In der Konstruktion aus Stahl und Beton befinden sich Ballasttanks. Der Schwimmer zieht die ganze Konstruktion so tief ins Wasser, bis ihr Schwerpunkt weit unter der Oberfläche liegt. Dies verhindert, dass das Windrad bei Wellengang zu stark hin- und herschwankt. Dank der Ballasttanks lässt sich der Schwerpunkt exakt einstellen. Damit das Windrad nicht abtreibt, wird es mit drei flexiblen Stahltrossen an Ankern auf dem Meeresboden vertäut. Der Strom wird über ein Seekabel abtransportiert. Siemens hat den Mast und eine Offshore-Turbine mit 2,3 Megawatt Nennleistung geliefert. Was den Teil über Wasser betrifft, kommt also etablierte Technik zum Einsatz. In Kombination mit dem Unterwasser-Schwimmer aber ist das ganze System derzeit eher avantgardistisch.
Sicher, die Idee, schwimmende Windparks im Meer zu errichten, ist nicht wirklich neu. Bis vor einem Jahr aber hatte es nur einige wenige Versuche gegeben, Windenergieanlagen ins offene Wasser zu bugsieren. Das Potenzial der schwimmenden Offshore-Technik ist gigantisch, denn mit ihr lassen sich viele Beschränkungen der küstennahen Windenergie abschütteln. Doch auch auf See konkurrieren Offshore-Anlagen mit einer Reihe anderer Belange, wie der Seeschifffahrt, der Fischerei oder dem Naturschutz. Andere Standorte in direkter Nähe des Ufers scheiden aus, weil dem touristische Interessen entgegenstehen. Weit draußen jenseits der 12-Meilen-Zone gibt es weniger Platzprobleme. Sjur Bratland, Projektleiter bei Statoil, sieht in der schwimmenden WEA schlicht eine Diversifizierung des Offshore-Marktes. „Wir können damit in deutlich größere Wassertiefen vorstoßen als bisher.“
Ab 70 Metern muss sie schwimmen
Flachmeere wie die Nordsee bieten reichlich Raum für herkömmliche Windanlagen, die fest im Meeresboden verankert werden. Offshore-Windanlagen wandern weiter hinaus in die Tiefe. Bis vor Kurzem war für die herkömmlichen Windenergieanlagen eine Wassertiefe von 20 Metern Stand der Technik. Derzeit gründet man in 40 Metern. Für die nahe Zukunft peilt die Branche 60 Meter Tiefe an. Nach Einschätzung von Bratland ist die klassische Bauweise aber nur bis zu einer Tiefe von etwa 70 Metern rentabel. Jenseits dieser Werte wird eine massive Pfeiler-Lösung unerschwinglich – und schwimmende Offshore-Anlagen attraktiv. Bratland geht davon aus, dass Turbinen nach dem Hywind-Prinzip in Arealen mit Wassertiefen von bis zu 700 Metern eingesetzt werden können.
Dass das erste schwimmende Windrad aus Norwegen stammt, ist auch der Geologie des Landes zu verdanken: Schon wenige Kilometer vor der norwegischen Küste fällt der Meeresboden steil ab. Zehn Kilometer vor der Insel Karmoy, dort wo Hywind im Wasser schwebt, sind es bereits 200 Meter Tiefe. Herkömmliche Offshore-Anlagen, die mit stählernen Stelzen auf dem Grund stehen, scheiden hier aus. Ähnlich ist die Situation vor Japan, Portugal oder den USA. Für Experten wie Bratland sind all dies potenzielle Märkte für schwimmende Anlagen.
Statoil und andere Energiekonzerne wollen sich mit derlei Projekten für die Nach-Öl-Ära rüsten. So scheuen die Konzerne auch den direkten Vergleich von Gas, Öl und Wind nicht. Nach Berechnungen von Statoil kann das Ormen-Lange-Gasfeld in der Nordsee in den kommenden 20 Jahren noch jährlich Gas für 125 Terawattstunden Strom liefern, was etwa einem Fünftel des deutschen Jahresstromverbrauchs entspricht. Dieselbe Menge, rechnet Statoil weiter, könnte der Wind in einem Seegebiet von 40 mal 70 Kilometern auf halber Strecke zwischen Norwegen und Schottland produzieren – auf ewig. Ob dabei die Nennleistung der Anlagen zugrunde liegt, verrät Statoil nicht. Doch macht dieses Rechenexempel die Dimensionen deutlich. Während das Windparkareal auf dem Festland in vielen europäischen Ländern knapp wird, könnte die schwimmende Windenergie ein riesiges Potenzial erschließen.
Vieles existiert nur auf dem Papier
Steffen Schleicher, Projektleiter Offshore bei der Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen (WAB), betrachtet diese Entwicklung eher nüchtern: „Der Markt dafür wird sich nicht in den nächsten zehn Jahren, sondern eher in den darauffolgenden Jahrzehnten entwickeln.“ Schleicher hat gute Gründe für seine vorsichtige Einschätzung, denn bislang hat die Branche, abgesehen von Hywind, zwar viel angekündigt, aber wenig Handfestes geliefert. Allerdings, räumt Schleicher ein, wird derzeit an vielen Designs gearbeitet. In den nächsten Jahren werden also voraussichtlich weitere Testanlagen im Meer installiert.
Das niederländische Unternehmen Blue H hat bereits 2007 einen Stahlschwimmer vor Apulien in Italien getestet. Es war die erste Firma überhaupt, die einen größeren Prototypen unter realen Bedingungen testete. In der Mitte der Konstruktion war eine kleine 200-Kilowatt-Anlage mit Zweiblatt-Rotor montiert. Das Unternehmen versprach, dass ein ausgewachsener Prototyp folgen würde. In Kooperation mit dem britischen Energy Technologies Institute wird jetzt eine größere Plattform in Italien und Bulgarien gebaut, auf der 2012 der Prototyp eines 1- bis 2-MW-Zweiflüglers aufs Meer gezogen werden soll. Das Fernziel ist der Bau einer eigenen 5-MW-Anlage, die Blue H derzeit entwickelt.
Drei Länder – drei Lösungen
Damit geht es den Entwicklern schwimmender Windanlagen etwa so wie jenen, die Strömungs- oder Wellenkraftwerke konzipieren – erste Prototypen sind getestet, aber bis der Markt wirklich in Schwung kommt, ist noch einiges zu tun. Momentan gibt es neben Hywind eine Handvoll ernstzunehmender Konzepte, die eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung einnehmen könnten:
Das norwegische Unternehmen Sway zum Beispiel, das seit einiger Zeit mit Areva kooperiert. Der Sway-Windradmast besteht ebenfalls aus einem schwimmenden Spar-Buoy-Rohr. Anders als Hywind ist er aber nur an einem Punkt am Meeresboden fixiert. Die Anlage soll sich damit so in den Wind drehen, dass sie von hinten angeströmt wird. Da sich der Mast um mehrere Grad in den Wind legt, wird die Anlage den Anstellwinkel von Rotor und Nabe variieren können. Wann der Prototyp im Meer steht, ist jedoch noch nicht sicher.
Einen Schritt weiter ist das US-Unternehmen Principle Power aus Seattle. Im kommenden Jahr will das Unternehmen den Prototypen eines schwimmenden Dreibeins vor Portugal zu Wasser lassen – die Windfloat-Anlage. Ihr Konzept besteht aus drei Stahlsäulen, die in Form eines Dreiecks miteinander verknüpft sind. Auf einer Säule steht der Mast mitsamt Windrad. Damit die Konstruktion bei Seegang nicht kippt, befinden sich in den Säulen Ballastwassertanks. Abhängig von Windstärke und -richtung passen Pumpen den Wasserstand jedes Ballasttanks automatisch an. Die Konstruktion hat einen wesentlichen Vorteil. Sie kann im Hafen komplett vormontiert und dann auf See geschleppt und dort abgesenkt werden. Schwere Kranschiffe, die Mast und Gondel auf dem Schwimmer installieren, braucht man nicht. Anders beim 100-Meter-Hywind-Stahlrohr: Das Monstrum kann in den flachen Küstengewässern nur liegend durchs Wasser gezogen werden. Vor Ort auf See müssen schwere Geräte es dann aufrichten und anschließend die Gondel hochhieven. Dafür muss das Wetter perfekt sein. Die vorkonstruierten Windfloats wären einfacher zu handhaben.
Kurz vor dem Prototypen
Die Windfloat-Anlage hat bisher nur Tests im Wellenkanal absolviert. Im nächsten Jahr soll sich das erste Windenergie-Floß in den Wellen des Atlantiks wiegen. Auch vor den US-Staaten Maine und Oregon will die Firma aufs Meer. Für ihre Entwicklung hat Principle Power im Energieversorger Energias de Portugal einen schlagkräftigen Venture-Capital-Geber gefunden – eine wichtige Voraussetzung, um mit der Idee am Markt Erfolg zu haben. Das Marktpotenzial für schwimmende Windanlagen vor den Küsten der USA, Europas und Japans taxiert Principle Power auf mehr als 1.000 Gigawatt. Zum Vergleich: Deutschland bringt es derzeit auf eine installierte Leistung von gerade einmal 25 Gigawatt.
Windernte auf hoher See, das klingt nach uneingeschränkter Freiheit. Jochen Bard, Meeresenergie-Experte beim Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, IWES, in Kassel, teilt diese Euphorie jedoch nur bedingt. „Mit zunehmender Entfernung zur Küste steigen die Kosten, nicht nur beim Bau der Anlage, sondern auch später bei der Wartung.“ Schiffstage sind teuer. Je länger ein Bautrupp oder eine Service-Crew unterwegs ist, desto kostspieliger der Einsatz. Und mit jedem Meter Entfernung zur Küste steigen zudem die Kosten für die Anbindung der Anlagen an das Stromnetz. Potenziell interessant sind daher zunächst küstennahe Tiefwassergebiete mit hohen Windgeschwindigkeiten.
Jochen Bard weiß, dass eine Meeresenergieform allein es schwer hat, sich zu etablieren. Als Koordinator des europäischen Projektes Orecca versucht er deshalb, die Fortentwicklung aller regenerativen Energieformen im Meer zusammenzuführen – von Welle, Wind und Strömung gleichermaßen. Orecca ist eine Expertenplattform, deren Mitglieder technische, aber auch raumplanerische Aspekte diskutieren. Dahinter steckt die Idee, verschiedene Technologien wie etwa Wellenenergiewandler, Meeresströmungsanlagen und schwimmende Windräder in Meeresenergieparks zu bündeln, statt wie bisher individuelle Flächen für jede einzelne Energieform auszuweisen. Mit einem einzigen Seekabel ließen sich so deutlich mehr Energiewandler ans Stromnetz anbinden. Das könnte auch die Genehmigungsverfahren vereinfachen. „Eine solche umfassende Herangehensweise kann die Entwicklung des Offshore-Marktes insgesamt deutlich beschleunigen“, sagt Bard.
Wind allein ist nicht genug
Orecca soll ausloten, welche rechtlichen Aspekte berührt werden. Zudem sieht das Projekt eine Art Technologie-Benchmarking vor. Welche Konzepte machen Sinn? Was lässt sich wie schnell umsetzen? Auch Gesichtspunkte wie der Ausbau der Hafeninfrastruktur, der Bau von Spezialschiffen, die Entwicklung erforderlicher Supply-Chains oder die Auswirkungen auf die Umwelt analysieren die Beteiligten. Bard und seine Mitstreiter wollen nach 18 Monaten eine Roadmap vorlegen, die klare Handlungsanweisungen für den Ausbau der Meeresenergie liefern soll. Dabei fühlt sich der IWES-Forscher durch das aktuelle Bestreben der EU bestätigt. Vor wenigen Wochen erst hat die EU öffentlich Projekte für ihre aktuelle Strategie „Oceans of tomorrow“ ausgeschrieben. Ziel der Strategie ist es, Managementpläne für die europäischen Meeresgebiete zu entwickeln – das betrifft nicht nur die
Energie, sondern auch die Fischerei. Die begrenzten Areale sollen möglichst sinnvoll, nachhaltig genutzt werden – am besten, indem man, ganz im Sinne von Orecca, verschiedene Nutzungsarten in einem Gebiet verknüpft. „Aquakultur in Windparkarealen zum Beispiel wäre keine allzu abwegige Idee“, meint Bard.
Der Optimierungsbedarf ist hoch
Bis Wellenenergiewandler neben schwimmenden WEA im Meer schaukeln, werden dennoch einige Jahre vergehen. Das sieht auch Sjur Bratland so. Denn obwohl bereits ein Prototyp im Wasser steht, sieht er weiteren Optimierungsbedarf. Zum Beispiel was das Gewicht der Anlage betrifft. „Je leichter die Anlage, desto geringer sind die Kräfte, die auf die ganze Konstruktion wirken.“ Zwar hat Siemens mit seiner getriebelosen Variante schon ein echtes Leichtgewicht geliefert, deren Maschinenhaus weniger wiegt als das vieler Getriebeanlagen vergleichbarer Leistung. Doch mit dem Wunsch nach mehr Leistung steigt auch das Gewicht. Siemens entwickelt derzeit eine Sechs-Megawatt-Maschine, die künftig auf Hywind-Strukturen der zweiten Generation aufgepflanzt werden soll. Leichtere, festere Stähle für die gesamte Anlage wären für Bratland eine Lösung. Auch die Kosten müssen sinken, weiß Bratland; zum Beispiel durch ein neues Kabeldesign oder Gleichstromübertragungstechnik, die mehr Strom transportieren kann. Gerade arbeitet Statoil drei Machbarkeitsstudien für drei verschiedene Seegebiete aus – die norwegischen Gewässer, die schottischen Gewässer und das Areal vor der Küste des US-Staates Maine. Derzeit entscheidet der Konzern, ob und wo neue Hywind-Anlagen errichtet werden.
Vier Millionen für ein Megawatt?
Vor der britischen Küste, wo Statoil als Teil des Forewind-Konsortiums neun Gigawatt errichten will, wird das Unternehmen auf die schwimmenden Windturbinen verzichten müssen: Das Windparkgebiet Doggerbank, eine Sandbank, die 125 Kilometer vor der britischen Ostküste liegt, bietet nur Wassertiefen von 13 bis 63 Metern und eignet sich damit gut für normale Gründungsstrukturen. Wirtschaftlich würden schwimmende Windenergieanlagen hier ausscheiden, denn Jochen Bard gibt zu bedenken: „Herkömmliche Offshore-Anlagen sind doppelt so teuer wie die an Land. Schwimmende Offshore-Anlagen wiederum sind doppelt so teuer wie die etablierte Offshore-Technik.“ Der große Durchbruch schwimmender Windturbinen wird noch auf sich warten lassen – aber mit jedem Jahr kommen neue Erkenntnisse hinzu. (Tim Schröder )