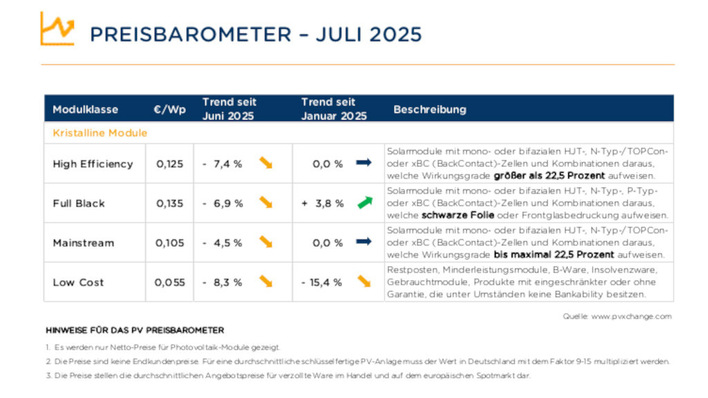Nach den Neuwahlen hat sich die Energiepolitik der Bundesregierung leicht verschoben. Mit welchen Unsicherheiten haben Sie als Projektierer derzeit zu kämpfen?
Daniel Hölder: Positiv hervorzuheben ist, dass sich die Bundesregierung zum Ziel der Klimaneutralität bis 2045 bekannt hat und den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorantreiben will. Zudem soll die weiterhin offene Umsetzung wichtiger Vorgaben von EU-Ebene, wie zum Beispiel der RED-III-Richtlinie, zügig in Angriff genommen werden. Dies ist zu begrüßen, da es zu weiteren Erleichterungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren führen wird. Wichtig und richtig ist ebenfalls, dass die Regierung plant, bestehende Hemmnisse für mehr Flexibilität abzubauen, den Smart-Meter-Ausbau voranzubringen und die Rahmenbedingungen für Batteriespeicher zu verbessern.
Aber?
Kritisch fällt uns auf, dass andere Teile des Koalitionsvertrags sowie erste Äußerungen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche der notwendigen Flexibilisierung unseres Stromsystems diametral entgegenstehen. Mit den geplanten Kraftwerksausschreibungen im Umfang von bis zu 20 Gigawatt scheint der Fokus eher auf der staatlichen Förderung von Gaskraftwerken als auf der Stärkung der Flexibilität zu liegen. Auch der diskutierte Industriestrompreis könnte falsche Anreize setzen und die notwendige Flexibilität auf der Verbrauchsseite bremsen. Ein flexibler Strommarkt ist die beste und nachhaltigste Möglichkeit, die Systemkosten zu senken und Industrieunternehmen von den günstigen Erzeugungskosten der Erneuerbaren profitieren zu lassen.
Größere Solarprojekte dauern in der Regel etwas länger. Wie sind die Auswirkungen der derzeitigen politischen Entwicklungen auf bereits geplante Projekte?
In der vergangenen Legislatur wurde auf regulatorischer Ebene viel erreicht, insbesondere in den Bereichen Flächenverfügbarkeit und Genehmigungsverfahren. Wie schon erwähnt, stehen mit der Umsetzung der RED III in nationales Recht in dieser Hinsicht weitere Verbesserungen auf der Agenda. Die Ausgangslage für die Planung und Genehmigung von Projekten hat sich daher in den vergangenen Jahren erst einmal verbessert.
Wird die neue Regierung diesen Pfad beibehalten?
Unser Eindruck ist, dass es auch im Interesse der neuen Bundesregierung liegt, den Erneuerbaren-Ausbau weiter voranzutreiben. Die zu bewältigenden Herausforderungen liegen aktuell hauptsächlich im Bereich des Marktdesigns: Der Erfolg der erneuerbaren Energien hat das deutsche Stromsystem grundlegend verändert. Das aktuelle Marktdesign hält jedoch nicht Schritt, weil es noch auf grundlastproduzierende Großkraftwerke ausgerichtet ist. Die größte Herausforderung für die Projektentwicklung sind deshalb aktuell die immer weiter sinkenden Marktwerte für Solarstrom – im Mai lagen sie unterhalb von zwei Cent pro Kilowattstunde!
Nestlé produziert mit Solarstrom aus einer Agri-PV-Anlage
Aber niedrige Strompreise sind doch ein Zeichen, dass die Energiewende auf gutem Weg ist?
Die Bundesregierung möchte den Stand der Energiewende und ihr weiteres Voranschreiten in einem sogenannten Energiewende-Monitoring prüfen. Wir sagen: Das Monitoring darf in keinem Fall dazu führen, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien infrage gestellt und damit ein erneuter Fadenriss im Zubau riskiert wird. Jüngst hat Agora Energiewende in einer Studie gezeigt, dass der Strompreis bei einem weiterhin ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien im Jahr 2030 um etwa ein Viertel niedriger ist als wenn der Ausbau nur zögerlich erfolgt – und das unabhängig von der Stromnachfrage! Daher sollte das Monitoring darauf fokussieren, wo die Weiterentwicklung unseres Stromsystems dem Ausbau der Erneuerbaren nachhinkt, und Wege aufzeigen, diese Versäumnisse zu beheben.
Welche Sicherheiten brauchen Sie, um solche großen Projekte jetzt längerfristig zu planen?
Die bedeutendste Sicherheit wäre, dass die Bundesregierung konsequent umsetzt, was sie im Koalitionsvertrag vereinbart hat: Hemmnisse bei der Flexibilisierung des Stromsystems müssen abgebaut werden, um die flexible Nutzung von erneuerbaren Energien sektorübergreifend zu verbessern. Momentan erleben wir, dass an vielen Stellschrauben zugleich gedreht werden soll: Neugestaltung des Erneuerbaren-Fördermechanismus, Zubau gesicherter Leistung über einen Kapazitätsmechanismus, die Anpassung der Netzentgeltsystematik durch die Bundesnetzagentur, dazu Regelungen auf Landesebene wie zum Beispiel die Beteiligungsgesetze. Jedes dieser Arbeitspakete wird Auswirkungen auf den Strommarkt haben und alle werden sich auch gegenseitig beeinflussen. Es ist wichtig, dass die beteiligten Akteure diese Wechselwirkung im Blick haben und die Maßnahmen vom Ziel her denken: Wie bringen wir mehr Flexibilität und marktwirtschaftliche Anreize ins Energiesystem?
Revamping auf dem Gewerbedach: Volle Leistung auf weniger Fläche
Das Solarspitzengesetz hat auch noch einige Veränderungen hinterlassen – unter anderem die Regelung, dass Solarstrom schon ab der ersten Viertelstunde bei negativen Börsenpreisen nicht mehr vergütet wird. Welche Auswirkungen hat das auf die Finanzierung der Projekte?
Das Abschmelzen der Vergütung bei negativen Preisen war bereits zuvor im EEG vorgesehen und die Aussetzung der Vergütung ab der ersten negativen Preisstunde/-viertelstunde hätte ohnehin ab 2027 gegriffen. Zwar wurde die Regelung nun vorgezogen, für die langfristige Projektplanung war sie allerdings schon vorher relevant. Zusätzlich wurde für Solaranlagen auch der Nachholmechanismus für entfallene Förderzeiträume angepasst. Diese werden nun nicht mehr einfach an das Ende der Förderdauer angehängt, sondern gewichtet nach Ertragsmöglichkeit und über die nachfolgenden Monate gestreckt. Welche Wirkung diese Anpassung in der Praxis haben wird, bleibt aber abzuwarten.
Warum?
Auf das eigentliche Problem der negativen Preise wird die neue Regelung kurzfristig aber nur geringe Auswirkungen haben, weil sie nur für Neuanlagen und nicht für den Bestand gilt und weil für Kleinanlagen Übergangsfristen vorgesehen sind. Auch mit der neuen Regelung werden vor allem Kleinanlagen also weiter ohne Rücksicht auf negative Börsenpreise einspeisen. Das Beispiel zeigt sehr gut, dass wir mit dauerhafter Flickschusterei am Status quo nicht ans Ziel kommen werden. Was wir benötigen, ist vielmehr eine konsequente Digitalisierung der Netze sowie eine Neuausrichtung des Strommarktdesigns, die Flexibilität und Marktanreize ins Zentrum stellt.
Schauen Sie sich jetzt verstärkt nach alternativen Finanzierungen um, wie PPA und wie sind da die Aussichten?
Da der PPA-Markt nicht vom restlichen Markt losgelöst ist, sind auch hier die negativen Preise und fallenden Marktwerte die größte Herausforderung. Gerade in den vergangenen zwei bis drei Jahren ist der PPA-Markt deutlich schwieriger geworden. Während Renditeerwartungen, Zinsen und die Projektkosten insgesamt gestiegen sind, sind die Marktwerte für Solarstrom weiter gefallen. Der PPA-Markt ist aber auch weiterhin vor allem für große Abnehmer interessant. Es ist deshalb zu begrüßen, dass mit dem Clean Industrial Deal auf europäischer Ebene ein Garantieprogramm der Europäischen Investitionsbank für kleinere PPA-Offtaker aufgesetzt wird. Auch die angekündigte Handreichung für die Integration von PPA in staatliche Fördermodelle wie Contracts for Difference –CfD – ist sehr zu begrüßen.
Digitalisierung ermöglicht PPA für mittelständische Unternehmen
Eine Lösung wäre ein zusätzlicher Speicher. Wie wirkt sich das Solarspitzengesetz auf die Planung von Co-location-Speichern aus
Speicher sind aktuell insgesamt ein wichtiges Thema, das nicht einzig auf das Solarspitzengesetz zurückgeführt werden kann. Trotzdem wurden mit dem Solarspitzengesetz wichtige Neuregelungen für Speicher geschaffen, wie zum Beispiel die Mischnutzung aus gefördertem und Netzstrom. Diese Regelungen greifen aktuell aber noch nicht, da die Bundesnetzagentur hierfür zunächst eine Festlegung erarbeiten muss, in der Detailanforderungen zu den neuen Regelungen geschaffen werden. Dies muss bis spätestens Juni 2026 geschehen sein und die Bundesnetzagentur sollte den Prozess zur Erarbeitung der Festlegung schnellstmöglich anstoßen.
Die Fragen stellte Sven Ullrich.