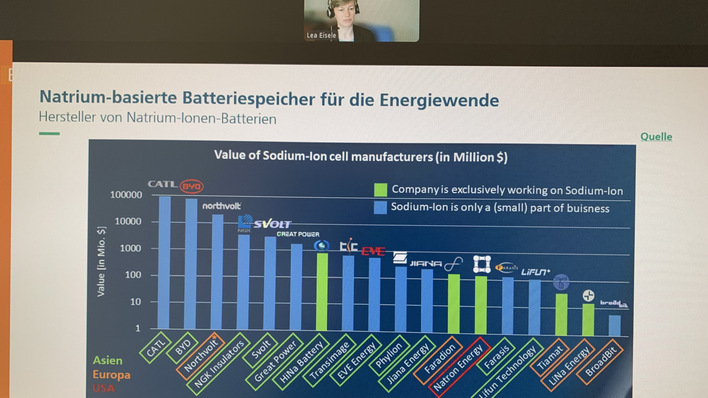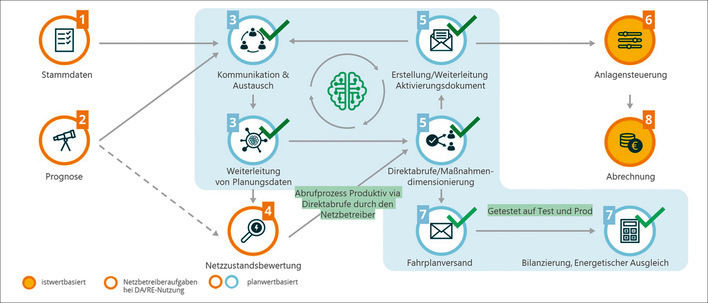_pik_bioenergieausbauDie Menschheit hat für Getreide für Brot zahllose Bäume abgeholzt und Wälder eliminiert. Jetzt treten zusätzlich Bioenergien auf den Plan und zugleich bleibt der Druck der Nahrungsmittelproduktion bestehen. Der Ausbau von Bioenergie und Nahrung ist bei Waldschutz möglich, sagt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.Foto: Andreas Hermsdorf/pixelio.de
Die Forscher setzten als Rahmenbedingung, dass der Ausbau von Biomasse zur energetischen Nutzung nicht zu Waldzerstörung führen darf. Mit der Prämisse, dass Wälder weltweit vor Abholzung und Umwandlung in Bioenergie-Felder geschützt sind, kann ein Deckungsgrad von 25 Prozent des geschätzten weltweiten Energiebedarfs im Jahr 2095 über Biomasse erreicht werden. Absolut 270 Exajoule, das sind 270 Trillionen oder 270*1018 Joule. Zweite Voraussetzung ist allerdings, dass parallel die Landwirtschaft jährlich immer effizienter wird.
Bioenergie wird mit CCS für Länder sehr attraktiv
„Wir haben den Modell-Ensembles das politische Ziel einer maximalen Erderwärmung von 2 Grad Celsius zugrunde gelegt. Darauf basierend wird der kostengünstigste Energiemix errechnet, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen“, sagt der Leiter der Studie Alexander Popp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Der Ausbau von Bioenergie wird insbesondere über die Kombination mit Carbon-Capture-Storage-Technologien (CCS) in Zukunft attraktiv. CCS bezeichnet die Abscheidung von Kohlendioxid aus Kraftwerksprozessen, das unterirdisch gespeichert wird (Sequestrierung). Zum einen werden durch den Anbau von Energiepflanzen Kohlendioxidsenken geschaffen, zum anderen wird über CCS-Technologie das Kohlendioxid gebunden, das bei der Verwendung von Biomasse im Energiesektor frei wird, so dass sich die Kohlendioxidemissionen durch den Einsatz von Bioenergie netto verringern. Über Bioenergie in Kombination mit CCS können so genannte negative Emissionen erzielt werden.
0,9 Prozent Ertragssteigerung per anno notwendig
Die Bioenergie hat aber einen großen Haken: Der globale Ausbau geht tendenziell auf Kosten von Wald. Zugleich steigt der Druck auf Fläche auch durch wachsenden Nahrungsmittelbedarf. „Wir haben mit dem Modell ausgerechnet, dass sich der Ausbau von Bioenergie und zugleich der Ausbau der Nahrungsmittelproduktion realisieren ließe bei gleichzeitigem Schutz von Wald“, sagt Popp. Dazu müssen allerdings die Erträge in der Landwirtschaft gesteigert werden. Die Modellrechnung hat ergeben, dass bei einem Ausbau von Bioenergie plus Waldschutz die Ertragssteigerungen pro Jahr 0,9 Prozent im Betrachtungzeitraum bis 2095 betragen müssen. Diese Werte liegen unterhalb der in der Vergangenheit erreichten Werte, wobei allerdings rückgängige Ertragssteigerung zu beobachten sind.
Flächenbedarf kann konserviert werden
Unter diesen Umständen kann es gelingen, einen Anteil der Bioenergie am Weltenergiebedarf bis 2095 von 25 Prozent zu erzielen ohne die Fläche dafür wesentlich auszuweiten. Der Flächenbedarf läge dann bei rund 1.500 Millionen Hektar, 1.450 Millionen Hektar sind es heute. Wenn allerdings keine flankierenden Waldschutzmaßnahmen stattfinden und außerdem die Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft zurück bleibt, wird es zur Ausweitung in die Fläche von Naturräumen gehen, hauptsächlich in tropischen Regionen. Das Modell macht deutlich, dass sich zugleich in bestimmten Regionen die Konkurrenz zwischen Bioenergie und Nahrungsmittelproduktion verschärft, was Preissteigerungen zur Folge hat.
Internationale Anstrengungen notwendig
„Unsere Empfehlung lautet, dass erstens der Waldschutz über internationale Abkommen vorangetrieben werden muss. Zweitens, dass es für die Bioenergieproduktion ein global deckendes Zertifikatesystem geben muss. Drittens, dass Forschung und Entwicklung für Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft verstärkt werden müssen“, sagt Popp. Eine weitere Möglichkeit den Druck auf das Landnutzungssystem zu reduzieren liegt im Verzicht tierischer Produkte. „Das allein schon würde den Druck auf die Fläche und auf den Wasserbedarf erheblich reduzieren.“ (Dittmar Koop)