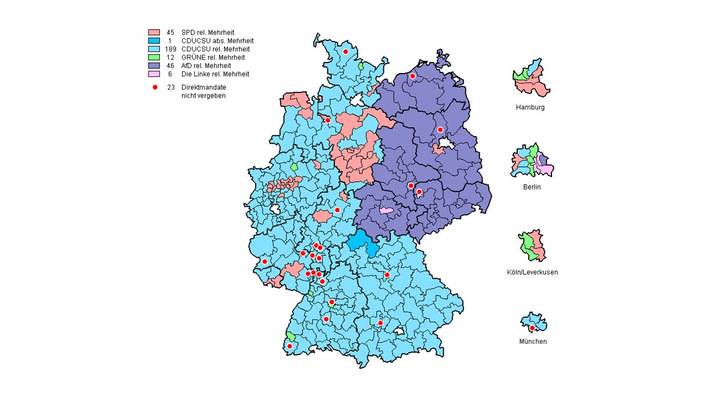Die erste polnische Offshore-Windenergieanlage steht an ihrem Platz im Gebiet des künftigen Meereswindparks Baltic Power. Das Errichter-Schiff Wind Osprey des mit der Turbineninstallation beauftragten Betreibers Cadeler stellte die erste der 260 Meter Gesamthöhe messenden und 15 Megawatt (MW) starken Windkraftanlagen auf ihren zylinderförmigen Gründungspfahl. Nun sollen die weiteren der insgesamt 76 vorgesehenen Vestas-Windenergieanlagen vom Typ V236-15.0 MW mit 236 Meter Rotordurchmesser folgen. Mit einer Parknennleistung von insgesamt 1,2 Gigawatt (GW) wird der Offshore-Windpark den Planungen entsprechend 2026 vollständig in Betrieb gehen.
Warschau feiert Anstich für Offshore-Windpark Baltic Power mit 1,2 Gigawatt
Ringen um Polens begehrte Offshore-Windpark-Flächen
Die Transporte und Errichtungen der Vestas-Anlagen gehen vom Hafen Rønne auf der am weitesten östlich gelegenen dänischen Insel Bornholm aus. Speziell einige der Maschinenhäuser sollen aber auch im neuen Vestas-Werk in Stettin entstehen. Aktuell finden Baufortschritte aber vor allem beim Eintreiben der 120 Meter langen Monopile-Gründungspfähle in den Seeboden und beim Aufsetzen der Transition Piece genannten Adapter zwischen Fundamentpfahl und Türmen statt.
Der Windpark Baltic Power gehört zur ersten Bauphase polnischer Meereswindparks, die im Rahmen einer Rechtevergabe für 5,9 GW Offshore-Windkraft ihre Zuschläge bekommen haben. Der polnische Offshore-Windkraft-Fahrplan sieht zwei Ausschreibungsrunden noch in diesem Jahr und 2027 vor, die zur Vergabe von Meereswindparkrechten für weitere 5 GW führen sollen. Die ersten 5,9 GW sollen noch bis 2030 ans Netz. Das Vergabeverfahren sieht eine vorangehende Zuteilung von Offshore-Windpark-Entwicklungsflächen vor – und im zweiten Schritt Ausschreibungen von staatlichen Differenzverträgen: Verträgen zwischen Windparkentwicklern und Staat über eine Vergütung der Stromeinspeisung auf Basis eines Orientierungspreises. Erzielen die späteren Betreiberunternehmen eines Offshore-Windparks im Stromhandelsmarkt einen geringeren Stromvermarktungspreis als der Auslösepreis es vorsieht, zahlt der Staat die Differenz als Zuschuss zum Stromhandel, erzielen sie im Stromhandel höhere Preise, zahlen die Betreibenden die jeweils aus dem Handel entstehenden Überschüsse zurück.