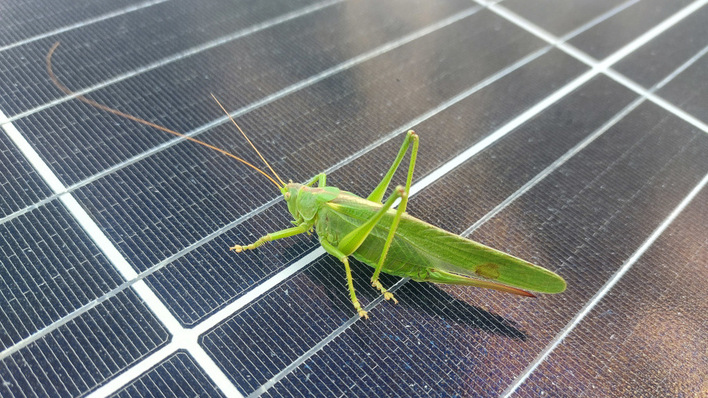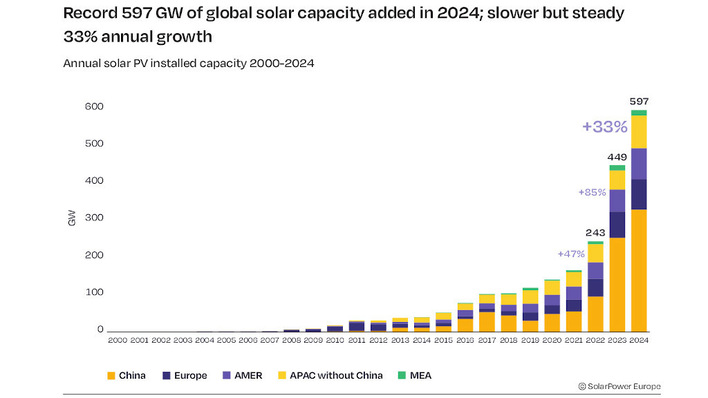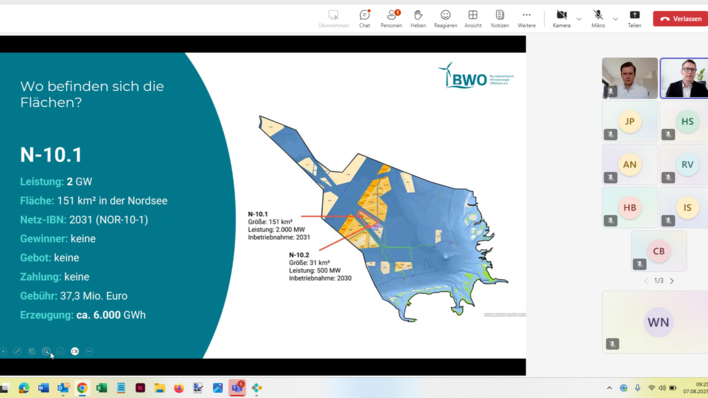Der ostfriesische Windenergieanlagenhersteller Enercon aus Aurich hat mit dem kanadischen Bionik-Unternehmen Biome Renewables in einer Absichtserklärung das Testen federähnlicher Hinterkantenprofile vereinbart. Sie sollen das Blattzischen drastisch mindern. Die von Biome Renewables entwickelten weichen und flexiblen Kunststoffprofile sollen im Flugwind nachgeben wie echte Federn und durch eine langgestreckte Zackenstruktur die Verwirbelungen in den Zwischenräumen mehrfach brechen. Dies soll dazu führen, dass für die Schallemissionen von Windenergieanlagen an den Rotoren verantwortliche Strömungsabrisse ausbleiben – beziehungsweise sich abschwächen. Erste Tests in einem Windpark zu Anfang dieses Jahres seien vielversprechend ausgefallen, erklärten die Partner.
Die Vereinbarung sieht nun eine Kooperation von Biome Renewables mit Enercon dabei vor, die Feather Edge genannten Profile für einen Einsatz an Anlagen des Windturbinentyps E-160 vorzubereiten und weitere Geräusche-Messungen daran vorzunehmen.
Höherer Schallpegel bei Windkraft durch angepasste Prognosen führt zu Problemen
Turbinenbauer schöpfen Leistungsreserven aus: Lärmkur für Siemens-Schwachwindturbine
Das kanadische Unternehmen geht davon aus, dass die Technik zu Lärmsenkungen beim Schallleistungspegel um bis zu drei Dezibel führt, unter bestimmten Luftverhältnissen sogar um bis zu fünf Dezibel. Eine Veränderung um drei Dezibel gilt unter Akustikexperten als Verdoppelung oder Halbierung des bisherigen Schallleistungspegels. Der Schallleistungspegel bezeichnet sämtliche von einer Windturbine in alle Richtungen abgegebenen Geräusche. Er berechnet den Lärmdruck so, als würden die Geräuschemissionen durch einen Trichter in ein Messgerät geleitet werden.
Falls es funktioniert, könnten die Federsäume auch Stromerzeugungsverluste von drei bis fünf Prozent im Schnitt für jedes vermiedene Dezibel ersparen. Denn um die häufigen Schallgrenzwerte an neuen Windparkstandorten einzuhalten, müssen Windparkbetreiber sonst häufig auch die Drehzahlen der Rotoren reduzieren und damit weniger Stromerzeugung in Kauf nehmen.