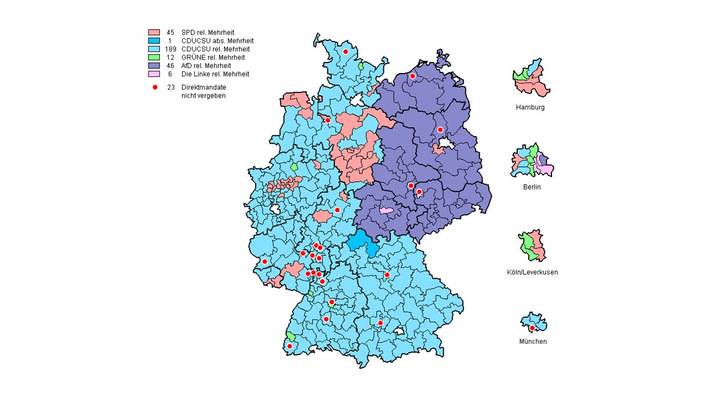Die größte Unterseekabelfabrik der USA entsteht ab sofort in Virginia. Wie der südkoreanische Mutterkonzern LS Cable & System bekannt gab, feierte dessen US-Tochterunternehmen LS Green Link die Grundsteinlegung für die nach Konzernangaben größte Fabrik ihrer Art in den USA. Die Anlage zur Herstellung von Hochleistungsgleichstromübertragungs-Kabeln für Offshore-Windparks gerade auch in den USA soll umgerechnet eine Investition von 681 Millionen Euro wert sein, wie das Unternehmen erfahren lässt. Die Fabrik entsteht am Standort Chesapeake und soll dort 330 Vollzeitjobs entstehen lassen. Der Bau soll 2027 im dritten Quartal zum Abschluss kommen, damit die Firma ihre Massenproduktion Anfang 2028 starten kann.
Donald Trump verfügt Pause und „Überprüfung“ der Windkraft in den USA
„Trump kann den Wandel in den USA zwar verlangsamen – aufhalten wird er ihn nicht“
2,6-GW-Windpark und Zwölf-MW-Turbine für die Ostküste
Das Unternehmen habe bereits 18 Monate an Produktion für Exporte nach Europa abgesichert, teilte LS Green Link mit. Die US-Daten-Center für große Computer-Rechenkapazitäten hätten heute schon Bedarf an 32 Gigawatt (GW) Versorgungsleistung. Bis 2030 alleine werde sich – wohl aufgrund des schnell wachsenden Bedarfs an Rechenleistungen für Digitalisierung und sogenannte künstliche Intelligenz – dieser Bedarf noch auf 120 GW weit mehr als verdreifachen. Dies werde auch den Bedarf an Offshore-Windstrom in den USA rasch nach oben treiben, deuten die Industrieinvestoren an.
Der Bau der Kabelfabrik beginnt in einem Moment, in dem infolge eines Erlasses durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump an dessen erstem Amtstag im Januar erste genehmigte Offshore-Windpark-Projekte mit behördlichen Baustopps versehen werden. So musste der norwegische Ölkonzern Equinor bereits Mitte April die weiteren Arbeiten am Offshore-Windpark Empire mit 810 Megawatt (MW) geplanter Erzeugungskapazität bis auf weiteres einstellen, nachdem die staatliche Behörde BOEM – Büro für das Management der Meeresenergie – ein Anhalten der Arbeiten auf See an dem Windparkprojekt angeordnet hatte. Diese sollten so lange ruhen, bis die Behörde die Vor- und Nachteile beziehungsweise Kosten und Nutzen genauer untersucht hätten und dann grünes oder rotes Licht signalisieren werden. Der Baustopp für Empire geht zurück auf Trumps Erlass, wonach keine neuen staatlichen Genehmigungen für Offshore-Windparks mehr erfolgen sollen. Genehmigte, aber noch nicht gebaute Projekte sollen sich zudem einer Überprüfung unterziehen: von Kosten – wie der Einfluss eines entstehenden Windparks auf die Strompreise – und Nutzen – etwa für die Beschäftigung. Eine Abwägung dazwischen soll schließlich neu über die Fortführung der Projekte politisch entscheiden lassen. Wie lange die Überprüfungen andauern dürfen und welche Kriterien im Detail zu prüfen sind, klärte der Erlass nicht.
Derweil gehen die Arbeiten am Offshore-Windpark Coastal Virginia Offshore Wind voran. In dem für 2,6 GW Erzeugungskapazität bemessenen Windkraftfeld vor Virginia, von Virginia Beach 43 Kilometer entfernt, setzten die Bauteams im März die erste von drei Umspannstationen auf ihrer Unterwasserfundament auf. Schon im November hatten die Errichter knapp die Hälfte der zylinderförmigen Monopile-Stahlfundamentstäbe in den Seeboden getrieben, vorgesehen sind 176 Siemens-Gamesa-Turbinen mit 14 Megawatt (MW) Nennleistung, die sich bei günstigen Windströmungen und angepasstem Wartungs- und Betriebskonzept mit bis zu 15 MW betreiben lassen. Die Monopiles liefert EEW SPC aus Rostock. Im Februar meldet das Projektentwicklungs- und Energieversorgungsunternehmen Dominion Energy, rund 50 Prozent der Errichtungsarbeiten erledigt zu haben, nachdem auch die ersten Transition Pieces montiert waren, die als Adapter zwischen Monopiles und Turbinentürmen dienen. Das in den USA gebaute Turbinenerrichtungsschiff sei bereits zu 96 Prozent fertig. Dominion erwartet, den Zeitplan einhalten und den Windpark bis Ende 2026 als komplett betriebsfertig abnehmen zu können.
Auch andere Unternehmen zeigen an, dass sie weiter auf den US-Markt und dessen längerfristige Offshore-Windkraft-Perspektive setzen wollen. Am Freitag – Anfang Mai also – meldete die niederländische Meeresbaufirma Deme, es habe den Kauf des Spezialschiffebetreibers Havram abgeschlossen. Hafram setzt die Monopiles für Coastal Virginia Offshore Wind und hatte zudem seine jüngsten Investitionen in neue Schiffe auf der Perspektive auf Aufträge aus dem US-Meereswindkraft-Markt begründet.
Anders als Coastal Virginia Offshore Wind musste der norwegische Ölkonzern Equinor die Arbeiten am auf knapp 900 MW ausgelegten Offshore-Windpark Empire vor New York im April einstellen. Der Monopile-Zulieferer des Projektes, Sif aus den Niederlanden, will allerdings die bestellten Monopiles ohne Unterbrechung weiter produzieren.
Insbesondere Projektentwicklungsunternehmen ziehen sich allerdings schon seit einiger Zeit schrittweise aus dem US-Offshore-Windmarkt zurück. Ende April meldete nun der deutsche Energiekonzern RWE, alle Offshore-Windpark-Projekte auf dem aktuellen Entwicklungsstand eingefroren zu haben. Betroffen sind Flächen für ein Windpark-Entwicklungsportfolio von 6 GW. Das Erneuerbare-Energien-Marktforschungsunternehmen Intelstor analysiert nun, das Dekret Trumps und dessen beabsichtigte Bremswirkung gegen den Offshore-Windkraft-Ausbau brächten zumeist ausländische Investitionen in Höhe von 75 Milliarden Euro in Gefahr.
Derweil folgt nun offenbar mit der niederländischen Regierung bereits ein Land der Europäischen Union auf den von der US-Administration eingeschlagenen Pfad, die Offshore-Windenergieplanungen zurückzudrängen. Die 2024 um die rechtsradikale PVV-Partei gebildete Koalitionsregierung entschied, das Ausbauziel von 50 auf 21 GW zurückzunehmen. Bis 2032 sollen die 21 GW gemäß bisherigem Zeitplan in Betrieb gehen. Die Regierung begründet die Rücknahme des 50-GW-Ziels mit dem Schutz der Fischerei. Sie nimmt ein 1.500-Quadratkilometer-Areal dafür aus einer großen schon ausgewiesenen Offshore-Windkraft-Nutzungszone heraus, das zugunsten der Fischereinutzung frei von Windturbinen bleiben soll. Das 50-GW-Ziel ist allerdings bislang nicht gestrichen. Es soll aber erst 2028 im neuen internationalen Nordsee-Programm wieder auf die Tagesordnung kommen.