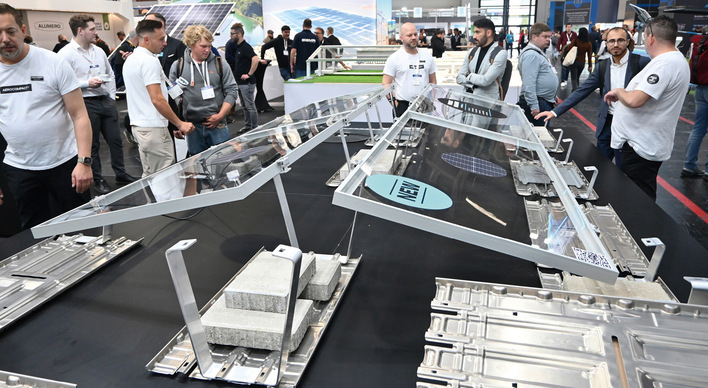Die Genehmigungen liegen vor, jetzt wollen viele Projekte starten. Schafft die Industrie das überhaupt?
Dennis Rendschmidt: Ja. Die Produktionskapazitäten in Europa sind ausreichend, es gibt sogar noch Spielraum nach oben. Hersteller passen ihre Lieferketten seit Jahren kontinuierlich an und können diese bei klaren politischen Rahmenbedingungen weiter ausbauen. Wenn mehr Projekte realisiert werden und die Rahmenbedingungen stimmen, sind sie in der Lage, auch ihre Kapazitäten zu erweitern.
Heißt das, die Kapazitäten waren zuletzt nicht voll ausgelastet?
Dennis Rendschmidt: Richtig, in den vergangenen Jahren gab es teils unausgelastete Kapazitäten.
Mit dem Hochlauf entsteht doch wieder Druck: Wann bekommen Kunden ihre Anlagen? Drohen erneut Lieferzeiten von 24 Monaten?
Dennis Rendschmidt: Vereinzelte Engpässe sind möglich, insgesamt halte ich die Lage aber für beherrschbar. Verzögerungen entstehen ohnehin oft an anderer Stelle – durch Genehmigungen, Transporte oder Netzkomponenten wie Transformatoren. Die Hersteller selbst können flexibel reagieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Nach dem Marktprinzip müssten die Anlagen mit steigender Nachfrage teurer werden. Und Rohstoffe sind ohnehin im Preis gestiegen. Bedeutet das höhere Kosten?
Dennis Rendschmidt: Nicht automatisch. Wenn das Angebot ausgeweitet wird, gibt es keinen Grund für steigende Anlagenpreise. Was sich allerdings auswirkt, sind globale Rohstoffpreise – zum Beispiel beim Kupfer. Das hat aber nichts mit Ausschreibungsmengen zu tun, sondern mit weltweiten Marktentwicklungen.
Kommen wir zum Thema Resilienz. Viele Anlagen enthalten heute große Anteile chinesischer Komponenten. Wie lässt sich die Unabhängigkeit erhöhen?
Dennis Rendschmidt: Resilienz bedeutet, Abhängigkeiten zu reduzieren – vor allem durch Diversifizierung. Je breiter die Lieferbasis, desto geringer das Risiko. Dafür sind zwei Punkte entscheidend:
Europa verfügt bereits über ausreichend Hersteller und Wettbewerb. Zusätzliche Anbieter aus China sind dafür nicht nötig. Wichtiger ist es, die heimische Produktion zu stärken.
Und wo könnten Unternehmen Alternativen finden? Alles aus China zu beziehen, dürfte ja nicht im Interesse einzelner Firmen sein. Viele denken doch längst über neue Bezugsquellen nach.
Dennis Rendschmidt: Genau, die Unternehmen prüfen bereits, wo sie alternativ sourcen können. Aber klar ist: Europa bleibt ein wichtiger Zuliefermarkt – was im Sinne der Resilienz entscheidend ist. Mein Eindruck ist, dass auch Indien zunehmend in den Fokus rückt. Aber das sage ich mit Vorsicht.
Sollte man sicherstellen, dass kritische Software nicht ausschließlich aus China kommt, oder sie eng überwachen?
Dennis Rendschmidt: Wir glauben, es geht um die gesamte Anlage. Ein Beispiel: Vestas – ein dänischer, also unkritischer Anbieter – verkauft weltweit Anlagen. Sie müssen diese jederzeit fernsteuern können, für Revisionen, Services oder Wartung. Problematisch wird es, wenn viele Anlagen in Europa von Herstellern aus Ländern stammen, mit denen die Zusammenarbeit im Konfliktfall schwierig sein könnte. Dann riskieren wir, dass unser Energiesystem – also kritische Infrastruktur – abhängig wird. Bei uns steuert nicht der Staat die Anlage, sondern der Hersteller, etwa Vestas, wenn er einen Serviceeinsatz in Basel durchführt. Wir sind uns nicht sicher, ob das bei Herstellern aus anderen Ländern genauso neutral gehandhabt oder im Ernstfall politisch genutzt würde. Deshalb muss die gesamte Anlage europäischen Cybersecurity-Vorgaben entsprechen – idealerweise den Nis-2-Richtlinien. Hier geht es nicht um einzelne Komponenten, sondern um die Windturbine als Ganzes. Nicole Weinhold