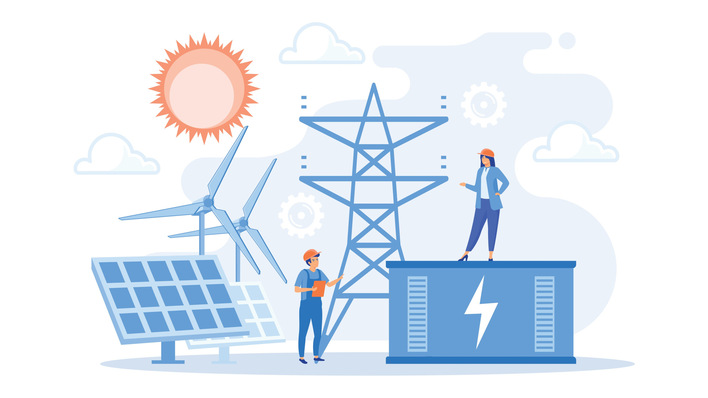Die erste Forschungsbohrung im Rahmen des Masterplans Geothermie hat in Krefeld ein größeres tiefengeothermisches Reservoir nachgewiesen als erhofft. In 380 Metern Tiefe sei das Team des Geologischen Dienstes (GD) Nordrhein-Westfalen auf Kohlenkalk gestoßen, eine Kalkstein-Formation der Karbon-Zeit, die deutlich größer war als zuvor angenommen, heißt es in einer Presseinformation.
„Die Wärmewende gelingt nur mit Geothermie“
„Unsere Prognose stimmte zunächst gut mit den tatsächlichen Untergrundverhältnissen überein“, sagt Stephan Becker, wissenschaftlicher Leiter der Forschungsbohrung. „Was seine Basis betrifft, wurden wir jedoch überrascht.“ Erst in einer Tiefe von 944 Metern – postuliert waren 725 Meter – war es schließlich geschafft und die über 363 Millionen Jahre alten Sandsteine der Oberdevon-Zeit, die die Unterkante des Kalksteins markieren, waren erreicht.
Stadtwerke München bohren tief: Neue Geothermieanlage soll 75.000 Bürger versorgen
Daten sammeln gegen das Fündigkeitsrisiko
Während die Bohrkerne der mehr als 340 Millionen Jahre alten Kalksteine noch ausgewertet werden, stellte sich bereits während der Bohrung heraus, dass der Kalkstein viel mächtiger ist als angenommen und es in großer Tiefe wassergefüllte Spalten und Hohlräume existieren, aus denen warmes Tiefenwasser gefördert werden kann, hieß es weiter. Der anschließend durchgeführte hydraulische Test habe ergeben, dass viel mehr Wasser aus dem Bohrloch an die Oberfläche gefördert werden konnte als erwartet. Nun werden die erbohrten Gesteinsproben und die durchgeführten Tests im Bohrloch ausgewertet, um Erkenntnisse für eine klimafreundliche Wärmeversorgung in der Region zu liefern.
Die neue Print-Ausgabe unseres Magazins ERNEUERBARE ENERGIEN ist da. Mehr Infos hier.
Nächste Bohrung 2026 in Köln
Wer in der Geothermie nach heißem Wasser in der Tiefe sucht, steht vor einem großen Fündigkeitsrisiko: Nicht immer sind die Bohrungen erfolgreich. Auch deshalb sind genaue Daten über die Beschaffenheit des Untergrunds wichtig, wie sie unter anderem im Explorations- und Bohrprogramms „Geowärme – Wir erkunden NRW“ ermittelt werden. Ziel des Programms ist es, die tief liegenden Wärmevorkommen in Nordrhein-Westfalen zu erkunden, um bis 2045 rund 20 Prozent des Wärmebedarfs durch klimafreundliche Geothermie zu decken. „Unsere Aufgabe ist es, fundierte geowissenschaftliche Daten bereitzustellen, damit Kommunen tragfähige Entscheidungen für ihre Wärmeplanung treffen können“, erklärt Ulrich Pahlke, Direktor des GD Nordrhein-Westfalen. Deshalb sollen auch in anderen Regionen weitere Forschungsbohrungen durchgeführt werden, die nächste Anfang 2026 in Köln-Dellbrück.
Geothermie boomt in Niedersachsen
Da die temporäre Forschungsbohrung die technischen und rechtlichen Anforderungen einer dauerhaften Produktionsbohrung nicht erfüllt, wird das Bohrloch nun wieder verfüllt und der Bohrplatz vollständig zurückgebaut.