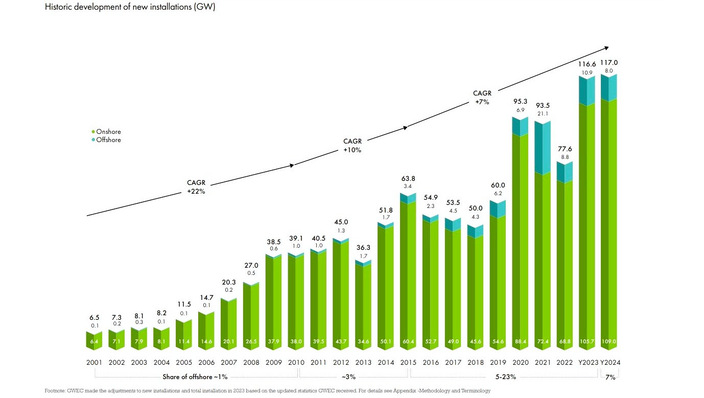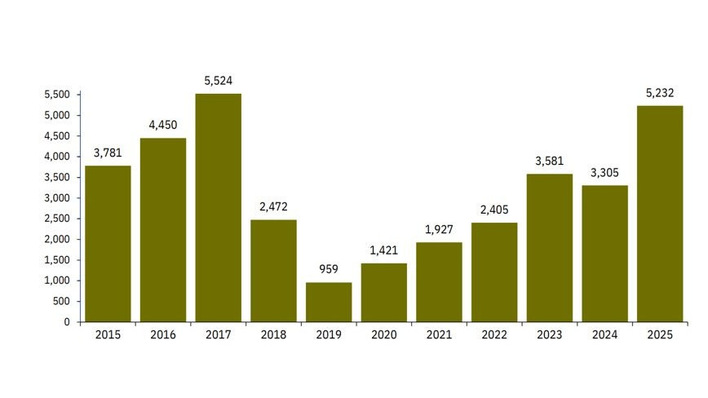Es ließe sich als Sommerlochnachricht abtun, wäre da nicht dieses Déjà-vu. So lässt sich im sprichwörtlichen Französisch das schon mal Gesehene des neuerlichen Angriffs einer Bundesregierung gegen den Windkraftausbau in Süddeutschland bezeichnen. Scheinbar ist nichts Neues passiert und die Widerstandskraft der bayerischen und mehr noch der baden-württembergischen Energiewendepolitik gegen die plumpe Polemik der neuen Energieministerin Katherina Reiche ist intakt.
Richtig ist, dass dieser Schein trügt, doch dazu ein klein wenig später noch mehr.
Bezüglich der Ambitionen der Ministerin Reiche sei zunächst erinnert: Die hatte Ende Juni in einem Wortbeitrag auf einer Tagung des Industrieverbands BDI den Ausbau der Erneuerbare-Energien-Anlagen pauschal als „völlig überzogen“ bezeichnet. Sie sieht sich offensichtlich vom Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU bestärkt, der nun eine Monitoring-Studie über den Zustand und die Wirksamkeit des Erneuerbaren-Kapazitäten-Ausbaus in Deutschland bis „Ende des Sommers“ vorsieht. Insbesondere stellt der Koalitionsvertrag das sogenannte Referenzertragsmodell in Frage. Es sieht vor, dass potenzielle Windparkstandorte in windschwächeren Regionen Süddeutschlands, die mindestens 50 Prozent der Erträge optimal windstarker Standorte wie in norddeutschen Küstenregionen versprechen, bei einem Zuschlag in den Projektausschreibungen einen Vergütungsaufschlag bekommen. Dieser Aufschlag gleicht die relativ höheren Kosten und auch geringere Ertragserwartungen der Schwachwindlagen aus. In Schwachwindlagen projektierende Unternehmen sollen somit im Vergleich zu Wettbewerbern mit norddeutschen Standorten in den Ausschreibungen überhaupt erst aussichtsreiche Gebote abgeben können.

Nicole Weinhold
Doch Katherina Reiches Angriff auf die süddeutsche Windkraft ist kein persönlicher, sondern wie erwähnt bereits im Koalitionsvertrag auf Druck der Unionsfraktionen angelegt. Die Angreifenden wollen vergessen lassen, dass schon einmal, nach Einführung der Ausschreibungen im Jahr 2014, sich die Wettbewerbsbedingungen für süddeutsche Projekte in Konkurrenz zu Bietern an norddeutschen Projektstandorten als unzureichend erwiesen hatten. Deshalb hatte die Ampelregierung der vorigen „rot-gelb-grünen“ Koalition aus SPD, FDP und Grünen im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 das Referenzertragsmodell so nachgebessert, dass einigermaßen windhöffige süddeutsche Standorte im Bieterwettbewerb immer ausreichend Chancen haben.
Die Angreifenden aus der Union, die sich derzeit noch hinter Frau Reiche als vermeintlicher Einzelakteurin in der Regierung verbergen, spielen mit dem falschen Bild eines Schwachwindstandortes mit zu schwachem Wind. Der lohne sich, aufgrund hoher Zuschüsse, auch wenn nur unzureichend schwacher Wind wehe. Und das sei wohl falsch.
Richtig ist, dass in der Südregion mit Baden-Württemberg und fast ganz Bayern sowie auch dem Saarland und Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen das Gros der seit 2023 bezuschlagten Projekte an Windstandorten mit 55 bis 65 Prozent Ertragserwartung des 100-Prozent-Referenzstandortes zum Zuschlag kamen. In den nördlich davon gelegenen Regionen kam das Gros der Zuschläge den Standorten mit einem Windgütefaktor von 70 bis 80 Prozent zugute. Dabei gleichen die süddeutschen Windturbinen den Windströmungsnachteil durch höhere Türme aus, mit denen die Projektentwickler mehr Nabenhöhe anvisieren. So strecken jüngste süddeutsche Anlagen die Rotoren um sechs Prozent höher in den Wind, als die Türme der norddeutschen Anlagen – wobei höhere Windströmungen steter und kräftiger sind als tiefer gelegene. Diese Daten gehen aus einer im Juni veröffentlichten Erhebung der Fachagentur Wind und Solar hervor.
Der Angriff erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem nach mehreren Jahren mit weitgehend ausgebliebenen Zuschlägen für neue Windparkprojekte in Bayern und Baden-Württemberg nun in beiden Bundesländern wieder mehrere und in Baden-Württemberg sogar viele Windparkerrichtungen stattfinden. Außerdem trifft eine weitere Vereinbarung im Koalitionsvertrag die süddeutschen Projektierungen genau jetzt. Denn die Koalition will auch die Ausweisungsvorgabe von bundesweit zwei Prozent der Landesfläche für Windkraftentwicklung auf den Prüfstand stellen – mit etwas höheren Vorgaben für Norddeutschland und etwas geringeren Vorgaben insbesondere für die beiden Südländer. Baden-Württembergs Kommunen arbeiten derzeit daran, bis zum Jahresende diese Flächen bereits ausgewiesen zu haben. Doch diese Kommunen könnten nun dazu indirekt verleitet werden, lieber nochmals damit abzuwarten.
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD alarmiert Windkraftakteure Baden-Württembergs
Wind an Land bei Zubau und Genehmigungen stärker als je zuvor
Das Déjà-vu besteht darin, dass bei der Einführung der Ausschreibungen 2014 der Protest gerade der von einem grünen und ausdrücklich windkraftfreundlichen Ministerpräsidenten geführten Landesregierung in Stuttgart sehr leise ausfiel. Eher achselzuckend hatten die Baden-Württemberger den Abbruch ihrer Windparkausbaubemühungen in Kauf genommen. Anfang Juli haben nun die von der Landesregierung betreute Wirtschafts-Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg und der Landesverband des Windkraftverbands BWE vor steigenden Energiekosten durch einen eventuellen Angriff auf das Referenzertragsmodell gewarnt. Ein langsamerer Windkraftausbau in Süddeutschland werde verhindern, dass die Stromnetze künftig wie eigentlich gewünscht gleichmäßiger als bisher ausgelastet werden, warnen diese. Ausbleibender süddeutscher Windkraftausbau vereitele somit zudem, dass die Grünstromeinspeisung effektiver und kostengünstiger werde.
Doch das Argument zieht nur, wenn die süddeutschen Landesregierungen klar sagen, dass sie mehr Windenergieausbau wollen: Weil es insgesamt dem Land und seiner Wirtschaft sowie seinen Menschen nutzt. Und auch der verlässlichen und kostengünstigen Stromversorgung. Aus München und aus Stuttgart ist dazu im Moment wieder wie vor 2014 wenig zu hören. Dass die Umweltministerin Thekla Walker von den Grünen am Mittwoch immerhin nochmals mahnend den Finger hob, dürfte nicht reichen: „Dieses Damoklesschwert über der Windbranche sollte der Bund schnellstmöglich einmotten“, notierte Walker im Kanal des Kurznachrichtendienstes X, wo sie zuletzt am 24. Mai auf das Problem warnend hingewiesen hatte.