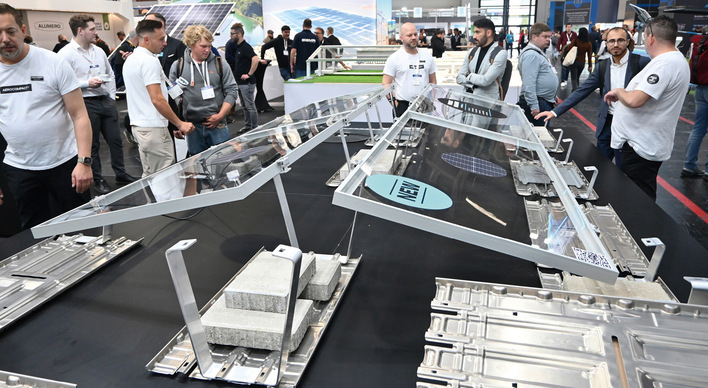„Auf dem Gipfel – was macht Merkel mit ihrer Macht?“, hatte TV-Talkmaster Frank Plasberg am Montag gefragt. Der Moderator der politischen Diskussions-Show Hart aber Fair im Ersten wollte fünf gestandene Persönlichkeiten die Ergebnisse des Gipfel-Treffens G7 analysieren lassen. Die G7 sind die wichtigsten sieben Industrienationen der Welt – die „Größten 7“ aus Sicht der sogenannten westlichen Bündnisse mit der Führungsmacht USA. Die G7- Regierungschefs hatten auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel unter einem gigantischen Polizeiaufgebot gerade zwei Tage über globale Probleme verhandelt. Die Plasberg-Runde – der deutsch-türkische Kabarettist Serdar Somuncu, Grünen-Chefin Simone Peter, Stern-Politikredakteur Hans-Ulrich Jörges, der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Merkel-Parteifreund Norbert Röttgen plus der US-amerikanische Kolumnist der Wochenzeitung Die Zeit, Eric T. Hansen – zoffte sich. Hansen und Röttgen versuchten den Hauptvorwurf der anderen abzuwehren. Der lautete: Die Bundeskanzlerin werde in der G7 zwar zunehmend zur Übernahme einer Führungsrolle gedrängt. Doch sie habe beim Gipfel in Bayern inhaltlich nichts erreicht, ihn sogar nur zur Show ihrer Macht genutzt. Das wichtigste Argument Hansens war bemerkenswert: In 100 Jahren werde die Welt rückblickend die grüne Revolution feiern, die in Deutschland ihren Ursprung gehabt habe, weil sie im Jahr 2100 ohne die klimaschädlichen Brennstoffe Öl, Gas und Kohle auskomme.
Es darf verblüffen, dass die Welt erst in 100 Jahren erkennen soll, was der G7-Gipfel in den bayerischen Alpen ihr gebracht hat. Ebenso erstaunlich darf anmuten, dass die Umweltschutzorganisationen aus Deutschland tatsächlich zu den ersten Gratulanten nach dem G7-Gipfel gehörten.
So jubilierte vor allen Greenpeace in Anspielung auf den Gipfel-Ort: „Elmau hat geliefert. Die Vision einer globalen Energiewende hin zu 100 Prozent Erneuerbaren hat deutlich Konturen gewonnen. Mit ihren Beschlüssen stimmen die G7 endgültig den Abgesang auf die Kohle an.“ Kaum euphoriegebremster der WWF: Die Bundeskanzlerin habe „mit ihrer Agenda-Setzung die Voraussetzungen geschaffen, um internationale Lösungen zu ermöglichen“. „Es ist ein sehr wichtiges Signal, …, die Daumenschrauben bei fossilen Energien anzuziehen“, ließ sich WWF-Deutschland-Vorstand Eberhard Brandes zitieren: „Der Countdown für die Nutzung von Kohle, Öl und Gas läuft.“ Selbst der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) ist zunächst froh: „Die Vereinbarungen … gehen in die richtige Richtung“.
Zwei Gründe für das Klima-Lob und ein Spannungsverhältnis
Dass Merkels G7 ausgerechnet in der Energiewende-Szene und bei Klimaschützern spontane Glücksäußerungen hervorgekitzelt hat – verdient zwei Erklärungen. Allerdings stehen beide in einem Spannungsverhältnis, das zu verstehen sich lohnt.
Die eine beruht schlicht darauf, dass der Gipfel einzig beim Klimaschutz echtes Medienecho erzeugte. Zu wenig greifbar waren die protokollierten Ergebnisse in den vielen anderen globalen Problemfeldern. Die militärisch, politisch und wirtschaftlich eng verflochtenen sieben Staaten USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan hatten festgehalten, noch in diesem Jahrhundert das weltweite Ende der Brennstoffnutzung von Öl, Kohle und Gas anzustreben. Sie bekannten sich zum Zwei-Grad-Ziel, wonach die Erderwärmung an dieser Schwelle halt machen muss. Und sie führten den Begriff der Dekarbonisierung ein: Durch immer weniger Ausstoß des für die Klimaerwärmung verantwortlichen Schadstoffs Kohlendioxid (CO2) aus der Brennstoffnutzung sollten sich die CO-2-Emissionen um 40 bis 70 Prozent im Vergleich zu 2010 reduzieren, darauf wollen sie die Mehrheit der Staaten auf dem kommenden Klimagipfel Ende 2015 in Paris verpflichten. Schließlich bekräftigte G7 die Energiewende bis 2050 abzuschließen.
Allerdings fielen die Medienberichte am Folgetag kritischer aus. So bemerkte nicht zuletzt Spiegel-Online eine „Klima-Mogelei von Elmau“: Denn weder bestimmten die G7-Protagonisten mit den Atomenergie-Großmächten Großbritannien, Frankreich, USA und Japan sowie den Kohle-Schwergewichten Deutschland und Großbritannien, wieweit ihre Energiewende eine Restbeteiligung fossiler Energien zulassen soll. Zudem widersprechen die nationalen Politiken der sieben Länder derzeit zu häufig den auf fast 100 Jahre gestreckten Maßnahmen. Wer kann etwa Bundeskanzlerin Merkel ihren G7-Erfolg abnehmen, ohne den Widerstand in ihrer Koalition gegen Pläne des Wirtschaftsministeriums zum schnelleren Ausstieg aus älteren Kohlekraftwerken zu vergessen? Das Zwei-Grad-Ziel ist außer für Japan und Kanada nicht neu – und die europäischen Staaten sind bereits auf 80 Prozent CO2-Reduktion bis 2050 verabredet – und das sogar verglichen zu 1990. Und schließlich fordern die G7-Mächtigen mit ihrem Beschluss viel von gar nicht auf dem Gipfel vertretenen Staaten ein: auch von Staaten wie den wirtschaftlichen oder militärischen Konkurrenten China und Russland, die sie erklärtermaßen nicht dabei haben wollten.
Energiewende nur für die Mächtigen?
Hier setzt die zweite Erklärung an: Offenbar können Klimaschützer wie Energiewendeprotagonisten mit den Mächtigen sich inzwischen im gedeihlichen Klima arrangieren. Dafür lieferten Geschehnisse um den Gipfel sogar ihre Symbolik. So schrieb wiederum Spiegel-Online im Vorspann eines Artikels über die kunterbunte, von einer Polizei-Übermacht eingedämmte Anti-G7-Protestszene mit kaum verhohlenem Spott: „Sie wettern gegen Kapitalismus, Krieg und Windparks.“
Windenergie als Argument, um jeglichen Protest der Ohnmächtigen lächerlich zu machen? Die Redakteure dürften die Windparks als rhetorischen Überraschungseffekt zum Leseanreiz eingesetzt haben. Doch der Fall ist ernst: Eine Vertreterin einer Ureinwohnergemeinde in Mexiko hatte gegen die Wirtschaftspolitik der Mächtigen mitprotestiert. Denn in ihrer Heimat am windreichen Küstenstreifen Isthmus plant ein Konsortium dreier europäischer Konzerne den Bau eines Riesenwindparks – ohne dass die Bevölkerung profitiert. Bei den örtlichen Protesten der Anwohner kommt es immer wieder zu Gewalt und Einschüchterungen gegen sie.
Klar ist der Bau von Infrastrukturprojekten in nicht astreinen Demokratien wie Mexiko immer schwierig. Doch während die Branche in Deutschland auf die Einbindung örtlicher Bürger und ihre Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg der Energiewende achten muss, kann sie anderswo unter Umständen ohne die ursprünglichen Grundlagen der Energiewende voranschreiten: Zu diesen gehören die Dezentralisierung einer Energiepolitik und die Beteiligung möglichst vieler Bürger.
Dass die Erneuerbaren weltweit in die gegenläufige Richtung zugunsten bestehender wirtschaftlicher Strukturen abdriften können, besorgen auch die zunehmende Einführung von Ausschreibungssystemen oder Entwicklungen am Kapitalmarkt. Für sie kann die Branche nichts. Doch droht dabei ihr weltweites Akzeptanzpotenzial verloren zu gehen. Dagegen müssten ihre Verbände weiter kluge Kritik üben.
(Tilman Weber)