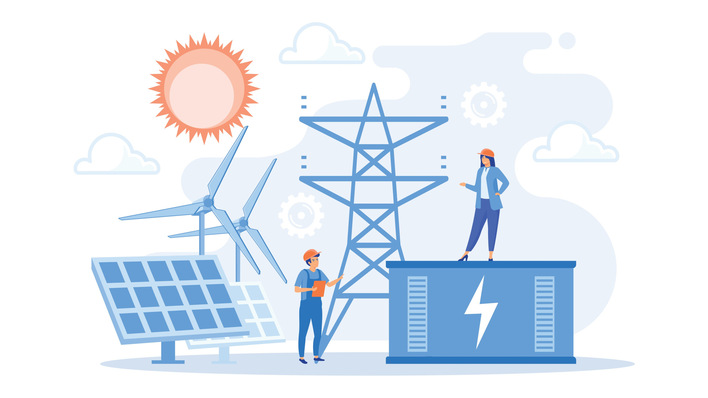Ein ganzer Drohnenschwarm soll Wissenschaftlern dabei helfen, die Nachlaufeffekte von Windenergieanlagen besser zu verstehen. Im Forschungswindpark Wivaldi in Krummendeich hat ein Forschungsteam des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein regelrechtes Ballett aus zehn Drohnen geübt und aufgeführt. Der Vorteil an dieser neuen Messmethode: Die kleinen Flieger können Daten erheben, wo stationäre Messgeräte nicht hinkommen: direkt vor und hinter den Windturbinen.
Video: So funktioniert die autonome Inspektion von Windenergieanlagen mithilfe von Drohnen
Wakes beeinflussen Lasten und Leistung
Im Fokus der Wissenschaftler und des Projekts NearWake steht die Ausbreitung des nahen Nachlaufs (Englisch near wake). Darunter versteht man die Strömung direkt hinter der Turbine einer Windenergieanlage, die weniger schnell und verwirbelt ist. „Meistens stehen Windenergieanlagen nicht allein, sondern zu mehreren in Windparks. Das bedeutet, der Nachlauf der einen Anlage trifft auf die nachfolgenden Anlagen. Das kann deren Leistung und die Lasten, die auf Rotorblätter und Anlagen wirken, erheblich beeinflussen“, erklärt Norman Wildmann vom DLR die Bedeutung des Forschungsprojekts. Bei der Planung eines Windparks müssen diese Turbulenzen berücksichtigt werden, um den Ertrag, aber auch die Lebensdauer der Windenergieanlagen möglichst genau abschätzen zu können.
Ein erstes Ergebnis der Messkampagne: Speziell die besonders turbulenten Luftwirbel an den Blattspitzen bewegen sich mit dem Wind im Nachlauf weiter mit als bisher angenommen. „So können wir in Zukunft viel exakter berechnen, welche Leistungen und Lasten erwartbar sind. Das unterstützt die Industrie dabei, Turbinen und ganze Windparks besser auszulegen und zu planen und den Betrieb entsprechend zu gestalten.“
100 Flüge in der Turbulenz
Um den Nachlauf-Effekten genauer auf die Spur zu gehen, führten ein DLR-Team mit einem Drohnenschwarm rund einhundert Flüge im Windpark Wivaldi durch. Die kleinen Drohnen sind weniger als ein Kilogramm schwer und für Windmessungen optimiert. „Sie sind der Turbulenz ausgesetzt und müssen gegensteuern, um ihre Position zu halten. Sie sind also selbst kleine Wetterfahnen“, erläutert der Forscher. Das Team konzentrierte sich auf eine Entfernung von maximal zwei Rotordurchmessern hinter der Turbine. In diesem Fall waren das 230 Meter. Die Einheit Rotordurchmesser erlaubt es, unterschiedlich große Anlagen zu vergleichen. Ein am DLR entwickelter Algorithmus bringt die gesammelten Messdaten zusammen und wertet sie aus. Weitere Erkenntnisse sollen dann bis zum Ende des Forschungsprojekts 2026 vorliegen.
Ultraschnell und dreidimensional: Neues Wind-Radarsystem liefert erste Daten