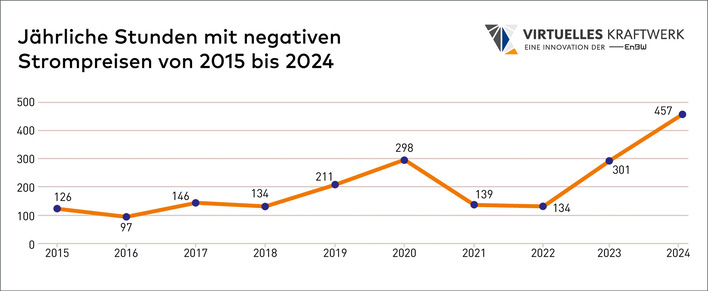Nach monatelangen Diskussionen hat sich die Bundesregierung auf eine neue Kraftwerksstrategie geeinigt: 2026 sollen Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von acht Gigawatt (GW) ausgeschrieben werden. Zusätzlich sind zwei GW „technologieoffen“ und zwei GW „wasserstofffähig“ für die Jahre 2026/2027 geplant. Alle Anlagen sollen so konzipiert werden, dass sie später mit Wasserstoff betrieben werden können. Damit fällt das Ausbauziel deutlich geringer aus als die ursprünglich von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche angekündigten „mindestens 20 GW“.
Die Reaktionen auf die Entscheidung aus Berlin fallen deutlich aus – und überwiegend kritisch.
Umwelthilfe: „Keine Begründung für fixierte Gaskraftstrategie“
Für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist das Ergebnis ein Rückschritt für den Klimaschutz. Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz bei der DUH, spricht von einer „schweren Schlappe für Wirtschaftsministerin Reiche“. Ihre ursprünglichen Pläne hätten die Wünsche der Gaslobby über die Klimaziele und das EU-Recht gestellt, so Zerger. Zwar sei der deutlich geringere Ausbauumfang ein Dämpfer für Reiches fossile Agenda, dennoch sei die Einigung „kein Grund zum Feiern“.
Zerger kritisiert insbesondere, dass der größte Teil der Kapazitäten nicht technologieoffen ausgeschrieben werde – innovative Speichertechnologien wie Batteriespeicher hätten damit weiterhin keine Chance. Zudem drohe die Fixierung auf Gas und die Option zur CO₂-Abscheidung (CCS-Technologie) den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft auszubremsen. Die DUH fordert daher Nachbesserungen an der Kraftwerksstrategie, um teure fossile Überkapazitäten und eine langfristige Abhängigkeit von Gas zu vermeiden.
Octopus Energy: „Regierung handelt widersprüchlich“
Auch aus der Energiebranche kommt deutliche Kritik. Bastian Gierull, Deutschlandchef von Octopus Energy, wirft der Bundesregierung widersprüchliches Handeln vor: „Während sie den Strompreis für große Unternehmen künstlich senkt, baut sie die teuerste Erzeugung überhaupt – wasserstofffähige Gaskraftwerke.“ Statt neue fossile Strukturen zu fördern, müsse die Politik endlich den Ausbau von Erneuerbaren Energien und die Integration von Elektrifizierung vorantreiben. Gierull betont, ineffiziente Strukturen ließen sich nicht dauerhaft wegsubventionieren.
Lesen Sie auch: Green Planet Energy legt Beschwerde gegen Subvention von Gaskraftwerken ein
Die Kraftwerksstrategie könnte auch auf europäischer Ebene für Konflikte sorgen. Der geplante Neubau soll durch staatliche Beihilfen finanziert werden, was eine Genehmigung durch die EU-Kommission erforderlich macht. Diese hatte bereits zuvor Zweifel an der Vereinbarkeit der deutschen Ausbaupläne mit dem EU-Beihilferecht geäußert. Ein Gutachten der Kanzlei K&L Gates, das im Auftrag der DUH erstellt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass die ursprünglichen Pläne nicht genehmigungsfähig seien.
Biogas als unterschätzte Alternative
Während die Bundesregierung auf Gaskraftwerke setzt, sehen Forscher im verstärkten Einsatz von Biogas eine realistische und klimafreundliche Alternative. Eine aktuelle Studie des Instituts für Zukunftsenergie- und Stoffstromsysteme (IZES), die im Auftrag des Fachverbands Biogas erstellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass Biogas in der politischen Planung unterschätzt wird. Laut den Autoren verfügt Biogas über das Potenzial, fossiles Erdgas bis Mitte der 2030er Jahre schrittweise zu ersetzen – und das in unterschiedlichen Anwendungsfeldern. Weil Biogas bereits heute verfügbar ist, könne es erheblich zur Versorgungssicherheit beitragen und helfen, einen fossilen Lock-In zu vermeiden.
Lesen Sie auch: Wie Öl- und Gasinvestitionen die Erneuerbaren ausbremsen
Auch für grünen Wasserstoff hat der Fokus auf neue Gaskraftwerke negative Folgen. Da keine verbindlichen Vorgaben für den Einsatz von grünem Wasserstoff existieren, fehlt ein klarer Nachfrageimpuls für die Produzenten von grünem Wasserstoff. Ohne ausreichende Nachfrage lohnt sich die teure Produktion von grünem Wasserstoff für viele Unternehmen nicht, was den Markthochlauf verzögert.
Klimapolitisches Signal zur Unzeit
Der Zeitpunkt der Berliner Einigung sorgt auch symbolisch für Kritik. Während auf der Weltklimakonferenz COP30 in Belém nach Wegen gesucht wird, den CO₂-Ausstoß global zu senken, fördert die Bundesregierung den Neubau fossiler Infrastruktur. In zwei Wochen beginnt zudem in Nürnberg die Biogas Convention & Trade Fair – die zentrale Branchenplattform für klimafreundliche Energieproduktion aus Biomasse. Dort wollen Hersteller und Forscher zeigen, dass Alternativen längst marktreif sind.
Die Entscheidung der Bundesregierung über die neue Kraftwerksstrategie zeigt, wie schwierig der Spagat zwischen Versorgungssicherheit und Klimaschutz bleibt. Umweltverbände und Unternehmen fordern, die fossilen Pfadabhängigkeiten endlich zu überwinden und technologieoffen in die Zukunft zu investieren. Ob die EU-Kommission die geplanten Förderungen genehmigt – und ob Berlin nachsteuert – wird entscheidend dafür sein, ob Deutschland seine Klimaziele erreicht oder weiter auf halbfossile Kompromisse setzt.