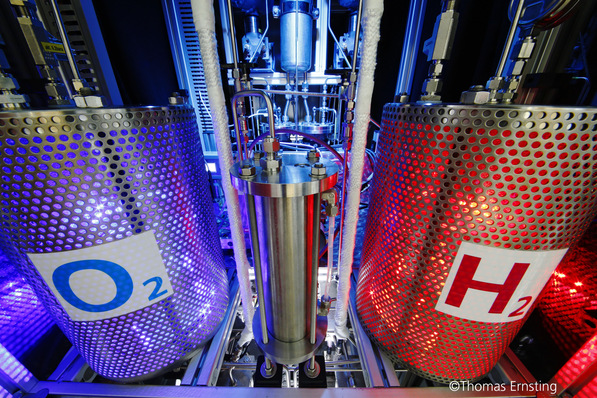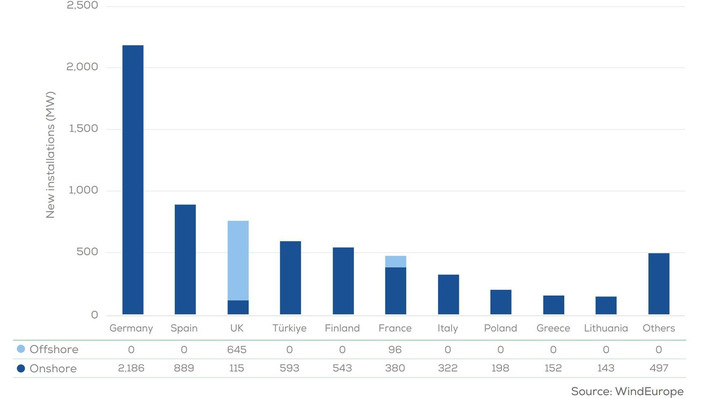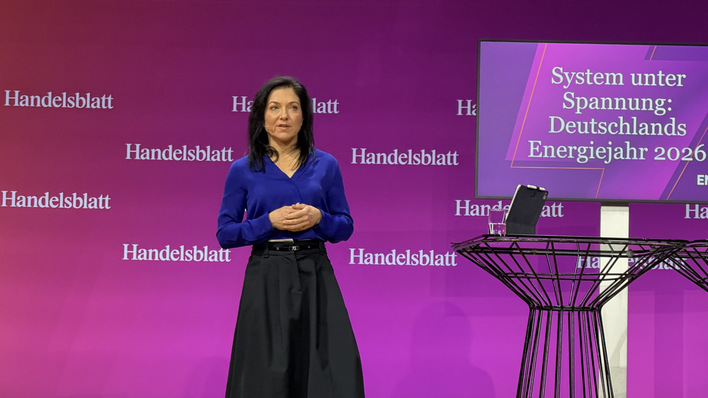Kaum noch vergeht ein energiepolitischer oder in der Erneuerbare-Energien-Szene brancheninterner Debattentag ohne eifrige Reden über die besten Wege zur Resilienz oder über eine bedarfsgerechte Grünstromerzeugung für die Zukunft. Selbstverständlich präsentieren die dann Sprechenden dabei stets ihre eigenen Ideen, Leistungen und Waren als die besten Mittel für diese Ziele. Das lässt nun offenbar gerade wieder vergessen, dass die Energiewende nur in einer breiten Anwendung durch eine hohe Beteiligung an Erzeugung und direktem Grünstromverbrauch richtig Sinn macht.
Während die von der Bundesregierung schon versprochene direkte Versorgung der Industrie mit Grünstrom auf sich warten lässt, ohne dass es offenbar wirklich auffällt, gilt dies erst recht für die Bürgerenergie.

Nicole Weinhold
Denn die Deutsche Umwelthilfe (DUH), das Bündnis Bürgerenergie (BBEn) und der Bundesverband Steckersolar (BVSS) haben nun kaum öffentlich wahrgenommen darauf aufmerksam gemacht, dass die breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erzeugung erneuerbarer Energie und gezielter Grünstromnutzung gerade scheitert. Für diese gebe es bestenfalls stumpfe Werkzeuge, so deuten es die drei Organisationen an. Die Bundesregierung müsse schnell „zu einem klaren Bekenntnis für die dezentrale Energiewende in Bürgerhand“ kommen.
Podcast: „Dezentralität selbst ist schon ein wichtiger Faktor für die Resilienz“
75 Prozent der Deutschen wollen Smart Meter nutzen
Smart Meter-Rollout in Deutschland: Warum der digitale Stromzähler auf der Bremse steht
Im Detail kritisieren sie drei Dinge: Den verschleppten Smart-Meter-Rollout, also eine schon um viele Jahre sich verspätende Verbreitung intelligenter digitaler Stromzähler mit dem Ziel, dass sich auch private Verbraucher selbstbestimmt mit ihrem Gebrauch der Elektrizität zeitlich an die vorhandenen Grünstrommengen im Stromnetz anpassen. Natürlich geschieht dies über die lenkende Wirkung der Strompreise abhängig von der Menge der kostenarmen Erzeugung aus Wind und Sonne. Und dank der Eigenversorgung der Bürgerinnen und Bürger durch Einbau von Strom-Speichern oder gar Strom-Wärme-Kopplungsanlagen zu Hause oder im Quartier. Auch der Rechtsrahmen für Energy Sharing reiche nicht aus, erinnern die drei Organisationen. Das am 13. November erstmals zugelassene Teilen von selbst erzeugtem Strom aus Grünstromanlagen muss einstweilen ohne wirtschaftliche Anreize durch entsprechende Regelung des Marktes auskommen. Auch „die Regelungen für Kleinspeicher mit und ohne Photovoltaik reichen bei weitem nicht aus“, monieren DUH, BBEn und BVSS.
Wohl zurecht. Mit erst drei Prozent erreichten Smart-Meter-Rollouts ist Deutschland im europäischen Vergleich weit abgeschlagen, das lässt die DUH wissen. Zudem erschweren „mangelnde Digitalisierung und uneinheitliche Datenformate zwischen Netz-, Anlagen- und Verbrauchsakteuren“ die Umsetzung beim Energy Sharing, wie
Valérie Lange betont, die Leiterin Energiepolitik und Regulierung beim BBEn. Kleinspeicher könnten als Bausteine in einer Größenordnung von Millionen Haushalten die Netze entlasten, heißt es bei BVSS. „Wir dürfen Bürgerlösungen nicht weiter unnötig verkomplizieren. Das ist ein strategischer Fehler.“
Mit der Folge, die Energiewende nicht wirklich zu verankern.