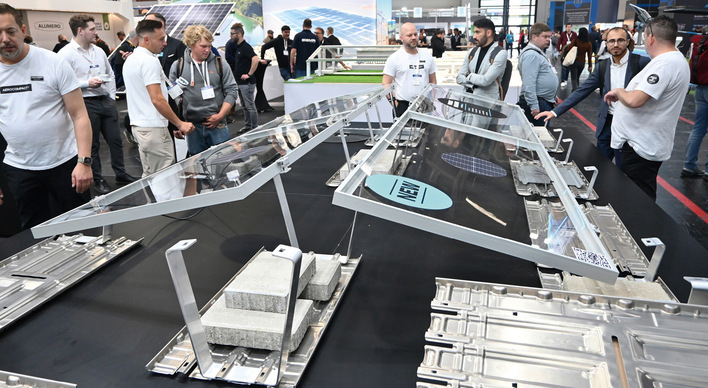Je mehr Leute mitreden, desto länger dauert die Diskussion. Angewandt auf Energiewendeprojekte könnte dies bedeuten: Je mehr Menschen beteiligt werden, desto länger dauert die Umsetzung.
Doch das ist nicht der Fall. Das Forschungsprojekt BePart hat Beteiligungsformate in rund 200 Wind-, Freiflächensolar- und Übertragungsnetzausbauprojekten in ganz Deutschland untersucht und kommt zu dem Schluss: Beteiligungsverfahren führen nicht zu Verzögerungen bei der Energiewende, sondern tragen zur Konfliktlösung und Akzeptanz bei. Trotz des Aufwandes seien sie daher eine lohnende Investition, heißt es in einer Presseinformation des Bündnisses Bürgerenergie, das gemeinsam mit dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, dem ECOLOG-Institut und der Renewables Grid Initiative diese Frage untersuchte.
Entscheidend ist die Qualität der Beteiligung
Doch ganz einfach ist es nicht. Es kommt auch auf die Qualität der Beteiligung an, ermittelten die Forschenden. Nur wenn die Beteiligungsverfahren qualitativ hochwertig und an die lokalen Bedingungen angepasst seien, könnten sie Konflikte minimieren, die Akzeptanz erhöhen und Impulse für die regionale Wirtschaft setzen, betonte Projektleiterin Franziska Mey vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit.
Aktuelle Umfrage: Auch Unionswähler wollen mehr erneuerbare Energien
Deshalb empfehlen die Forschenden, beim Projektmanagement gezielter zu kommunizieren und engagierte Bürger als Mittler einzusetzen. Sie könnten eine wichtige Brückenfunktion zwischen den Projektträgern und der lokalen Bevölkerung einnehmen, hieß es. Bei der Wahl der Beteiligungsformen sollten Projektierer und Kommunen Konfliktdynamiken vor Ort berücksichtigen: Beteiligungsmaßnahmen müssten an die Situation angepasst werden. Wenn die Fronten bereits verhärtet sind, brauche es professionell moderierte Veranstaltungen und manchmal auch aufwändigere Mediationsverfahren. Dafür müssten die Landesregierungen Ressourcen bereitstellen, weil gerade kleinere Kommunen diese in der Regel nicht hätten, forderten die Forschenden.
Erste Sättigungseffekte
Gleichzeitig zeigte sich, dass Beteiligung kein Allheilmittel ist. Zahlungen für Wind- und PV-Parks nach EEG oder den Beteiligungsgesetzen der Länder wirkten nicht automatisch konfliktmindernd, wie die Forschenden feststellten. Vielmehr komme es auf regionale Dynamiken an: Kooperationsbereitschaft, Skepsis gegenüber Veränderungen und die Anfälligkeit für Falschinformationen spielten eine größere Rolle als die finanzielle Beteiligung der Kommune.
Der EEG-Cent: Ein Schlüssel zur Akzeptanz
In einigen Regionen mit bereits stark ausgebauter Windenergie traten zudem bereits erste Sättigungseffekte in der Bevölkerung auf, ergab das Projekt. Interviewpartnerinnen und -partner schlossen aus, dass Beteiligungsmaßnahmen hieran etwas ändern könnten. Sie berichteten zudem von zunehmenden Polarisierungen in kommunalen Entscheidungsgremien, die den Ausbau erschwerten.
Verzögerungen bei Wind und Solar eher den Behörden geschuldet
Was den Einfluss auf die Dauer der Verfahren betraf, zeigten sich je nach Technologie jedoch Unterschiede: Bei Windenergie an Land und Photovoltaik-Freiflächenanlagen hatten Beteiligungsmaßnahmen keinen nennenswerten Einfluss auf die Projektlaufzeit. Verzögerungen entstanden in fast der Hälfte der Fälle durch behördliche Genehmigungsverfahren und Planungsprozesse, während die Beteiligungsmaßnahmen selbst nur eine geringe Rolle spielten. Nur in wenigen Fällen führten Mitspracherechte, beispielsweise bei Projektanpassungen, zu Verzögerungen.
So funktioniert eine sozial gerechte Finanzierung der Energiewende
Beim Netzausbau hingegen verlängerte Beteiligung einzelne Projekte. Die Forschenden führen das auf die höhere Komplexität der Planungs- und Genehmigungsprozesse und die größere Anzahl von Akteuren zurück. Beteiligung lohne sich dennoch, weil sie das Vertrauen in eine gerechte Umsetzung der Energiewende fördere.